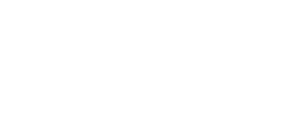Vom 18. bis 23. Juni zeigen die internationalen Filme die Vielfalt des jüdischen Lebens: vom Thriller über Komödien bis zum beeindruckenden Dokumentarfilm. Insgesamt sind es 71 Filme aus 15 Produktionsländern, darunter Kanada, Australien und Spanien.
"Das JFBB gibt Impulse für Diskussionen und Gespräche - immer, aber in diesem Jahr vielleicht nochmal besonders. Mit der Auswahl der Filme wollen wir Diskursräume offenhalten und schaffen, gerade jetzt wo das vielfach schwierig ist. Was sehen wir und was sehen wir nicht, das ist für mich wichtig - wir wollen den Blick auch auf das lenken, was in gegenwärtigen Debatten unsichtbar bleibt", so Programmdirektorin und Leiterin eines BMBF-Forschungsprojekts an der Filmuni, Dr. Lea Wohl von Haselberg, zum Konzept des anstehenden Jüdischen Filmfestival.
Klicken Sie sich hier durch den PROGRAMMKALENDER, sortiert nach Tagen.
Oder hier durch die PROGRAMMÜBERSICHT, in der Sie alles über die einzelnen Sektionen lesen können.
Alle spannenden (und kostenlosen) Panel-Diskussionen finden Sie hier.
Im Mittelpunkt der Jubiläumsausgabe stehen erneut die beiden Wettbewerbe um den besten Spiel- und Dokumentarfilm. Ergänzt durch FERMISHED, das bunt gemischte Genre-Kino. Dort findet sich auch das Kurzfilmprogramm NOSH NOSH (jiddisch für Leckereien).
Mit den terroristischen Angriffen der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung ist Terror wieder verstärkt im Fokus. Die medial inszenierte Gewalt, gekennzeichnet durch Skrupellosigkeit und Entgrenzung, dringt in die Wohnzimmer und besonders über die sozialen Medien in die Privatsphäre von Menschen überall auf der Welt ein, verbreitet Angst und Verunsicherung.
Die Filmreihe Der Angst begegnen - Filmische Reflektionen von Terror, Trauma und Widerständigkeit erinnert, mittels verschiedenartiger filmischer Ansätze, an Anschläge auf die jüdische Welt und die globale Gesellschaft. Gezeigt werden Filme wie SUPERNOVA. THE MUSIC FESTIVAL MASSACRE (Yossi Bloch/Duki Dror, IL 2023), der die Ereignisse des 7. Oktober in Israel anhand von Handyaufnahmen und Zeugenaussagen rekonstruiert. Der Film DER ZWEITE ANSCHLAG (Mala Reinhardt, DE 2018) lässt die Familien der Menschen zu Wort kommen, die vom sogenannten ‚NSU‘ ermordet wurden und erzählt von den rassistischen Verdächtigungen der Ermittlungsbehörden als einer zweiten Gewalt, der die Angehörigen ausgesetzt sind. Der Spielfilm MAIXABEL (Iciar Bollain, ES 2021) wiederum zeigt die baskische Gesellschaft, wie sie auch Jahre nach dem Ende des ETA-Terrors versucht, die tiefen Wunden der Gewalt zu überwinden.
Begleitet wird das Filmprogramm von Paneldiskussionen, in den Expertinnen und Experten die unterschiedlichen Formen des Terrors und ihre medialen Inszenierungen diskutieren.
Im Staatssozialismus sowjetischer Prägung kam es von 1945 bis zum Fall des Eisernen Vorhangs immer wieder zu antisemitisch unterfütterten Kampagnen und auch im Alltag waren antisemitische Einstellungen präsent. Der Bogen reicht von den Slánský-Prozessen in der ČSSR über Zwangsausweisungen in Polen 1968 bis zur "antizionistischen" Propaganda in der DDR. Die Filmreihe Bruch oder Kontinuität? „Antizionismus“ und Antisemitismus im Sozialismus und danach zeigt, wie das Thema zwischen den Zeilen in zeitgenössischen Filmen adressiert und nach 1989 aufgearbeitet wurde.
Die Filmreihe zeigt Klassiker wie Paweł Pawlikowskis IDA (PL/DK/FR/GBR 2013) oder Alexander Askoldows DIE KOMMISSARIN (UdSSR 1967). Mit dabei sind auch eine Kafkaeske Anspielung auf die Slánský-Prozesse und Konrad Wolfs GOYA (DDR 1971), der ebenfalls als Anspielung auf die Schauprozesse im Stalinismus gelesen werden kann. In DDR-Propagandafilmen wie DIE STÜRMER (Dagobert Loewenberg, DDR 1967) und TV-Dokumentationen wie ISRAEL ’74 (Sabine Katins DDR 1974) wird eine frappierende inhaltliche Nähe zur gegenwärtigen Israel-Kritik von links deutlich, einschließlich der Überschneidungsbereiche zum Antisemitismus.
Der tschechische Dokumentarfilm SON OF A PUBLIC ENEMY (Eva Tomanová, CZ 2022) zeigt am Beispiel von Otto Šling, einem der in den Slánský-Prozessen zum Tode Verurteilten, wie die unterschiedlichen Traumata der Shoah und der Schauprozesse im Sozialismus bis heute weiterwirken und in Marcel Łozinskis SIEBEN JUDEN IN MEINER KLASSE (PL 1991) treffen sich Jüdinnen und Juden wieder, die 1968 aufgrund der antisemitischen Kampagne der Regierung von Wladisław Gomułka Polen verlassen mussten.
Mit der Ausstellung Sex. Jüdische Positionen thematisiert das Jüdische Museum Berlin die Bedeutung von Sexualität im Judentum aus vielfältigen Perspektiven. Die begleitende Filmreihe beim Jüdischen Filmfestival Berlin und Brandenburg ergänzt die Ausstellung mit Filmen über Tabus, Begehren, Sexarbeit, sowie den Kampf um sexuelle Aufklärung und Gleichstellung. Spaßig, ernst, politisch, provokant und sexy ist das Kurzfilmprogramm, das in die verschiedensten Welten jüdischer Sexpositionen verführt: Religiöse Vorschriften, das Berlin der 30er Jahre, Ausflüge in die BDSM-Szene. 90 Minuten brechen auf unterschiedlichste Weise mit Stereotypen und gängigen (Vor)Stellungen.