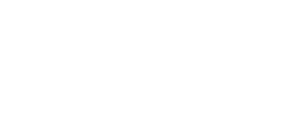24. Tagung der Fachgruppe Methoden der DGPuK
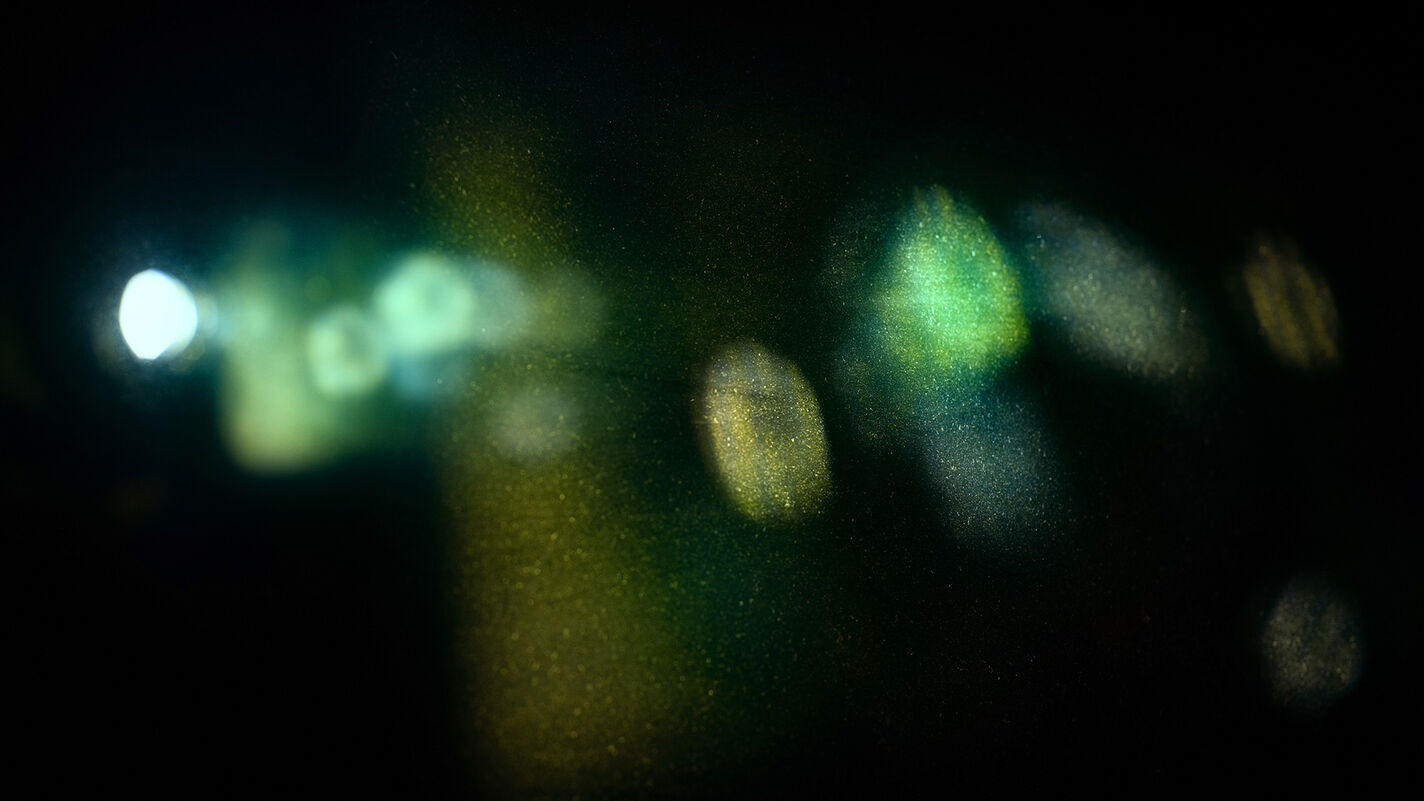
Die Jahrestagung der Fachgruppe Methoden der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (DGPuK) wird 2023 von der Filmuniversität Babelsberg organisiert und vom 27.-29. September 2023 in Potsdam ausgetragen. Sie erfolgt in enger Kooperation mit dem BMBF-geförderten Projekt Forschungsethik in der Kommunikations- und Medienwissenschaft (FeKoM), das gemeinsam von Prof. Dr. Daniela Schlütz (Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF), Prof. Dr. Wiebke Möhring (TU Dortmund), Dr. Arne Freya Zillich (Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF ), Eva-Maria Roehse (TU Dortmund) und Dr. Elena Link (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover) durchgeführt wird.
Call for Papers
Call for Papers für die 24. Tagung der Fachgruppe „Methoden der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft“ der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (DGPuK)
- Mittwoch, 27. September, bis Freitag, 29. September 2023, in Potsdam
- Ausrichtende: Dr. Arne Freya Zillich & Prof. Dr. Daniela Schlütz, Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF
Das Zusammenspiel von Methodik und Forschungsethik in der Kommunikations- und
Medienforschung
Gute kommunikationswissenschaftliche Forschungspraxis muss sich sowohl an methodischen als auch ethischen Kriterien messen lassen (Schlütz & Möhring, 2018). Forschungsethik – also der respektvolle und wertschätzende Umgang mit allen an empirischen Forschungsprojekten beteiligten Personen – gewinnt in der Kommunikations- und Medienwissenschaft (KMW) zunehmend an Bedeutung. Denn die KMW greift in Forschung und Lehre aktuelle gesellschaftliche Wandlungsprozesse wie Digitalisierung, Globalisierung und Individualisierung auf. Dadurch wandeln sich Forschungsfelder und Methoden, sie werden zunehmend komplexer und stellen Forschende vor neue ethische Herausforderungen. Besonders deutlich wird dies bei Studien, die mit Big Data arbeiten oder computerunterstützte, automatisierte Auswertungsverfahren verwenden. Sie werfen neue ethische Fragen z. B. hinsichtlich der informationellen Selbstbestimmung und des Datenschutzes auf (Buchanan & Zimmer, 2021).
Aber auch bei etablierten Methoden und Designs wie standardisierten Befragungen, Leitfadeninterviews, Ethnografie, teilnehmenden Beobachtungen oder experimentellen Studien können methodische und ethische Kriterien in Widerspruch zueinanderstehen (Iphofen, 2020; Matthes et al., 2015; Podschuweit, 2021; von Unger, 2018). Forschungsethische Fragen können auf jeder Stufe des Forschungsprozess auftreten: Studiendesign, Stichprobenziehung, Rekrutierung der Teilnehmenden, Datenerhebung, -speicherung, und -analyse sowie Veröffentlichung der Ergebnisse bzw. Daten (Schlütz & Möhring, 2018).
Die 24. Tagung der Fachgruppe „Methoden der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft“ der DGPuK nimmt diese in den Blick, indem sie konzeptionelle, methodische und methodologische Perspektiven sowie praktische Erfahrungen zum Zusammenspiel von Methodik und Forschungsethik in der Kommunikations- und Medienforschung adressiert. Einreichungen zum Tagungsthema können sich mit forschungsethischen Herausforderungen innerhalb folgender Themenbereiche auseinandersetzen, sind jedoch nicht auf diese beschränkt. Die Themenbereiche sind nicht überschneidungsfrei und dienen vor allem der Illustration. Einreichungen zu einem anderen Themenbereich sind darüber hinaus willkommen.
- Organisation wissenschaftlicher Studien: Meist ist die forschungsethische Reflexion empirischer Studien von administrativen Herausforderungen begleitet. Daher sind Einreichungen erwünscht, die praktische Erfahrungen mit der Beratung und Begutachtung durch Ethikkommissionen, Drittmittelgeber, Zeitschriftenredaktionen sowie hochschulinternen Verwaltungsstellen (wie dem Rechtsamt oder dem bzw. der Datenschutzbeauftragten) diskutieren und reflektieren. Sie können sich z. B. auf die organisatorischen Rahmenbedingungen, die fachliche und juristische Expertise der Begutachtenden oder alternative Begutachtungskriterien beziehen.
- Forschung zu problematischen oder sensiblen Themen: Bei Forschung zu problematischen oder sensiblen Themen wie gesundheitsbezogenen Themen, Hate Speech oder Rechtsextremismus sind ethische Frage besonders virulent. Diese tangieren oft Aspekte des Datenschutzes und der Anonymität der Studienteilnehmer*innen, aber auch der Gefährdung oder Belastung der Forschenden und Forschungsassistent*innen.
- Forschung mit vulnerablen Zielgruppen: Studien, die mit vulnerablen Gruppen wie Kindern und Jugendlichen, Geflüchteten, Migrant*innen, Arbeitssuchenden oder Mitgliedern von (Online-)Selbsthilfegruppen arbeiten, stehen vor jeweils spezifischen forschungsethischen Herausforderungen. Sie umfassen u. a. den Zugang zum Feld, die informierte Einwilligung (z. B. Proxy Consent) sowie eine mögliche (Re-)Traumatisierung oder Reproduktion von Stereotypen.
- Täuschung in experimentellen Studien: In experimentellen Studien kann es nötig sein, die Teilnehmer*innen zu Beginn einer Studie zu täuschen. Je nach Studiendesign und Studienthema können sich hierdurch forschungsethische Herausforderungen hinsichtlich des gewählten Stimulus, des Debriefing oder der Schaden-Nutzen-Abwägung ergeben.
- Forschung zu Inhalten in den (sozialen) Medien: Für die Analyse von textuellen, visuellen oder audiovisuellen Medieninhalten stehen zahlreiche Verfahren zur Verfügung, die sowohl manuell, computergestützt als auch automatisiert durchgeführt werden können. Diese können einhergehen mit rechtlichen, technischen und ethischen Fragen z. B. der Privatsphäre, des Datenschutz oder der Belastung durch die Codierung.
- Kombination von Datensätzen: Der technische Fortschritt erleichtert, Datensätze mittels Computational Methods miteinander zu kombinieren. Hierdurch ergeben sich sowohl Chancen als auch Risiken z. B. für die Nutzung von Sekundärdaten, die Replikation von Studien, die Verwertung der Befunde durch Dritte oder die De-Anonymisierung der Daten.
- Open Science und Forschungsdatenmanagement: Ein nachhaltiger und offener Umgang mit Forschungsmaterialien und -daten fördert die Transparenz, Reproduzierbarkeit und Nachnutzung von Forschungsergebnissen. Die Strukturierung, Organisation, Dokumentation, Sicherung und Archivierung der eigenen Forschungsmaterialien und -daten wird häufig von forschungsethischen Fragen z. B. hinsichtlich des Zugangs durch Dritte, des Datenschutz oder eines möglichen Datenmissbrauchs begleitet.
- Dilemmata: Die oben genannten beispielhaften Themenbereiche veranschaulichen, dass methodische und ethische Kriterien bei der Konzeption, Durchführung, Auswertung und Publikation von empirischen Studien in Widerspruch zueinanderstehen stehen können. Willkommen sind Einreichungen, die diese Dilemmata aufzeigen, reflektieren und ggfs. mögliche Lösungsansätze diskutieren.
- Best Practice: Darüber hinaus bietet die Tagung den Rahmen, um gelungene, praktische Lösungen für forschungsethische Fragen in der eigenen Forschung vorzustellen und mit den Tagungsteilnehmer*innen zu diskutieren.
Offenes Panel
Darüber hinaus bietet die Tagung in einem oder mehreren offenen Panels Platz für die Diskussion von Beiträgen jenseits des Tagungsthemas. Hier eingereichte Vorschläge sollen sich durch methodische Relevanz für das Fach auszeichnen. Dafür sind Kolleg*innen aus allen Fachbereichen
eingeladen, Beiträge aus sämtlichen Methodenbereichen vorzustellen. Bitte vermerken Sie auf Ihrer Einreichung, dass es sich um einen Beitrag für ein offenes Panel handelt. Es gelten die gleichen formalen Kriterien für Einreichung und Bewertung wie für Vorträge innerhalb des Tagungsthemas.
Interaktive Formate
Ferner sind Einreichungen für interaktive Formate abseits der klassischen Tagungsvorträge möglich. Vorgesehen sind dafür einstündige Zeitslots, für die Vorschläge inklusive einer Beschreibung des genauen Themas, beteiligten Personen und grobem Format/Ablauf eingereicht werden können. Berücksichtigt werden sowohl diskursive (z.B. Thesencafé) als auch praktische (z.B. Workshop) Formate. Ziel der interaktiven Formate soll es sein, das Tagungsthema auf anderer Ebene zu erweitern oder zu vertiefen. Über die Annahme entscheiden die Veranstalter*innen in Absprache mit den Sprecher*innen unter Berücksichtigung des gesamtenProgramms.
Einreichung
Einreichungen für alle Formate sind als Extended Abstract (800 bis max. 1.200 Wörter inkl. Literatur sowie Abbildungen/Tabellen und Titelseite) via ConfTool einzureichen. Deadline für Einreichungen ist der 15.06.2023. Der Beitrag darf in dieser Form nicht bereits in einer Verlagspublikation veröffentlicht oder auf einer wissenschaftlichen deutschsprachigen Tagung präsentiert worden sein. Allerdings sind Beiträge möglich, die einen methodischen Aspekt aus einer bereits publizierten oder präsentierten Studie herausgreifen, wenn dieser Aspekt nicht Hauptgegenstand der Publikation oder Präsentation war.
Bei der Einreichung muss jeder Beitrag einer der folgenden Kategorien zugeordnet werden:
- Vorstellung neuer Erhebungs- und Auswertungsverfahren: Der Beitrag dient vorrangig der Information über ( für die Kommunikationswissenschaft) neue Erhebungs- und Auswertungsverfahren und neu entwickelte Tools, die für empirisch Forschende hilfreich sein können (sog. „Es gibt/Es sollte geben“-Beiträge). Vorgestellte Verfahren werden nicht systematisch in ihrer Güte analysiert. Der Beitrag zielt außerdem nicht auf die Lösung eines konkreten Problems ab, sondern ihm kommt vorrangig ein Inspirations- und Weiterbildungscharakter zu.
- Lösung eines konkreten Problems mit Hilfe neuer Erhebungs- oder Auswertungsverfahrens: „Es gibt“-Beitrag mit kommunikationswissenschaftlichem Problem. Der Beitrag präsentiert also einen diskutierbaren Vorschlag sowie Felder und Problemstellungen der Kommunikationswissenschaft, für die das neue Erhebungs- oder Auswertungsverfahren geeignet ist, sodass nicht lediglich ein kleines Beispiel ohne weitere Abstraktion präsentiert wird.
- Originäre Methodenforschung: Der Beitrag präsentiert und untersucht ein Erhebungs- oder Auswertungsverfahren systematisch hinsichtlich methodischer Eigenheiten, Stärken und Schwächen. Insbesondere sind hier auch vergleichende Methodenstudien willkommen. Die kommunikationswissenschaftliche Bedeutung und Anwendungsfelder müssen explizit thematisiert werden.
- State-of-the-Art-Vorträge: Der Beitrag gibt einen Überblick über zentrale Bereiche der kommunikationswissenschaftlichen Methodenforschung. Aus einer meta-analytischen Perspektive beleuchtet er Ansätze, Forschungsdesiderate und Bedarfe.
Review
Im Rahmen der Fachgruppentagung wird ein konstruktives Feedback-Verfahren das traditionelle Review-Verfahren ersetzen. Dabei werden eingereichte Beiträge zwar anonymisiert nach den üblichen Kriterien begutachtet; Gutachtende sind aber angehalten, primär konstruktive Vorschläge für die Verbesserung der Beiträge zu unterbreiten. Die Reviews dienen vorrangig den Einreichenden als Feedback sowie der Tagungsleitung zur Orientierung. Die Tagungsleitung behält sich vor, auch die Gesamtkonzeption der Tagung bei der Auswahl der Beiträge zu berücksichtigen. Bei Einhalten aller formalen Vorgaben und unter Berücksichtigung räumlicher und zeitlicher Kapazitäten ist das Ziel, möglichst viele der eingereichten Beiträge anzunehmen.
Die Kriterien für die konstruktive Begutachtung eingereichter Beiträge sind:
- Relevanz für die Fachgruppe: Stellt die Einreichung einen eigenständigen substanziellen methodischen oder methodologischen Beitrag zur Kommunikations- und Medienforschung dar?
- Prägnanz der Darstellung: Ist die Einreichung gut strukturiert und verständlich formuliert? Enthält die Einreichung alle zur Begutachtung notwendigen Informationen, z. B. zur Stichprobe, Reliabilität und Validität? Werden bei empirischen Studien konkrete Ergebnisse präsentiert?
- Inhaltliche Stringenz: Bei empirischen Beiträgen: Sind Konzeption und Durchführung der vorgestellten Studie theoretisch und methodisch angemessen und entsprechen dem aktuellen State-of-the-Art? Bei nicht-empirischen Beiträgen: Ist die relevante Literatur auf dem Gebiet adäquat berücksichtigt? Werden explizit Anwendungsbezüge zur Kommunikations- und Medienforschung hergestellt?
- Bezug zum Tagungsthema (nicht im offenen Panel): Nimmt die Einreichung explizit Bezug auf das Tagungsthema, ggf. konkret auf einen Punkt im Call for Papers? Wird der Bezug plausibel hergestellt?
Paul-Lazarsfeld-Stipendien
Über die Paul-Lazarsfeld-Stipendien wird in einer separaten Ausschreibung informiert.
Mittelbau-Workshop
Über den Mittelbau-Workshop im Vorfeld der Tagung wird in einer separaten Ausschreibung informiert.
Rahmen
Die Tagung beginnt am Mittwoch, den 27. September 2023, abends mit einem Get-Together und endet am Freitag, den 29. September 2023.
Angebot für Tagungsbesucher*innen mit Kindern
Die Fachgruppe setzt sich für eine familienfreundliche Organisation der Tagung ein. Tagungsbesucher*innen mit Bedarf nach Kinderbetreuung sind gebeten, sich im Vorfeld direkt mit den Ausrichtenden in Verbindung zu setzen.
Publikation zur Tagung
Im Nachgang zur Tagung erscheint eine Special-Issue-Ausgabe in der Zeitschrift Publizistik. Einreichungsfrist für Abstracts in Deutsch oder Englisch mit max. 500 Wörter Länge (exkl. Quellenangaben) ist der 30. Juni 2023. Den Call for Papers finden Sie hier.
Für die ausrichtende Universität: Arne Freya Zillich & Daniela Schlütz, Potsdam
Für die Fachgruppe: Emese Domahidi, Ilmenau & Julia Niemann-Lenz, Hamburg
Literatur
- Buchanan, E. A., & Zimmer, M. (2021). Internet research ethics. The Stanford encyclopedia of philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/ethics-internet-research/
- Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG (Hrsg.). (2013). Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. In Sicherung Guter Wissenschaftlicher Praxis (2. ergänzte Auflage, S. 1–109). Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. https://doi.org/10.1002/9783527679188.oth1
- Iphofen, R. (2020). Ethical issues in research methods. In R. Iphofen (Hrsg.), Handbook of Research Ethics and Scientific Integrity. Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76040-7_54-1
- Matthes, J., Marquart, F., Naderer, B., Arendt, F., Schmuck, D., & Adam, K. (2015). Questionable research practices in experimental communication research: A systematic analysis from 1980 to 2013. Communication Methods and Measures, 9(4), 193–207. https://doi.org/10.1080/19312458.2015.1096334
- Podschuweit, N. (2021). How ethical challenges of covert observations can be met in practice. Research Ethics,1–19. https://doi.org/10.1177/17470161211008218
- Schlütz, D., & Möhring, W. (2018). Between the devil and the deep blue sea: Negotiating ethics and method in communication research practice. Studies in Communication | Media, 7(1), 31–58. https://doi.org/10.5771/2192-4007-2018-1-31
- von Unger, H. (2018). Forschungsethik, digitale Archivierung und biographische Interviews. In H. Lutz, M. Schiebel, & E. Tuider (Hrsg.), Handbuch Biographieforschung (S. 681–693). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18171-0_57
Einreichung
Ihre Beiträge können Sie hier einreichen: https://www.conftool.net/dgpuk-methoden2023
Paul Lazarsfeld-Stipendien
Auch in diesem Jahr unterstützt die Paul Lazarsfeld-Gesellschaft e.V. unsere Fachgruppe bei der Nachwuchsförderung. Das Stipendium ist eine Auszeichnung für wissenschaftlich hervorragende Arbeiten.
Die Lazarsfeld-Gesellschaft vergibt 2023 maximal drei Stipendien, um herausragende Student*innen bzw. Absolvent*innen der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft für besonders anspruchsvolle oder innovative Studien- und Abschlussarbeiten im Bereich der Methoden auszuzeichnen. Ziel ist, die ausgezeichneten Personen an das wissenschaftliche Berufsfeld heranzuführen.
Die Fördersumme pro Stipendium beträgt 1.000 EUR. Sie ermöglicht es den Stipendiat*innen u.a., ihre Studien- bzw. Abschlussarbeit im Rahmen des Paul Lazarsfeld-Panels auf der Methoden-Tagung zu präsentieren.
Die Vergabe der Paul Lazarsfeld-Stipendien erfolgt über ein Vorschlagsverfahren. Vorschlagsberechtigt sind alle DGPuK-Mitglieder; Studierende und Absolvent*innen können sich nicht selbst vorschlagen. Vorschläge sind bitte bis zum 15.06.2023 via Conftool möglich.
Die Vorschläge sollen in Form von pdf-Dateien jeweils enthalten: (1) das Erstgutachten (bei Studienarbeiten: ein Empfehlungsschreiben), (2) ein Abstract der Arbeit sowie (3) die Studien- oder Abschlussarbeit. Über die Vergabe der Paul-Lazarsfeld-Stipendien entscheidet ein Review-Gremium bestehend aus Mitgliedern der Fachgruppe.
Weitere Informationen zu den Stipendien erteilen gerne:
- Prof. Dr. Jens Vogelgesang (j.vogelgesang(at)uni-hohenheim.de)
- Prof. Dr. Emese Domahidi (emese.domahidi(at)tu-ilmenau.de)
- Dr. Julia Niemann-Lenz (julia.niemann-lenz(at)uni-hamburg.de)
Programm
TAGUNGSABLAUF
Das detaillierte Tagungsprogramm finden Sie hier
Mittwoch, 27. September 2023
- 12:30 – 14:00 Uhr: Workshop des Mittelbaunetzwerks Forschungsethik in der Lehre. Ein Blick auf Integrationsmöglichkeiten und didaktische Tools
Ort: Medieninnovationszentrum Babelsberg (MIZ), Stahnsdorfer Str. 107, 14482 Potsdam
Chair: Eva-Maria Roehse - 14:00 – 14:30 Uhr: Pause
- 14:30 – 17:30 Uhr: Workshop des Mittelbaunetzwerks Einführung in plattformübergreifende Forschungsdesigns mit Digital Trace Data. Mit Hands-on Workshop zur Datenerhebung mit der Telegram-API
Ort: Medieninnovationszentrum Babelsberg (MIZ), Stahnsdorfer Str. 107, 14482 Potsdam
Chair: Kilian Bühling - 18:00 – 22:00 Uhr: Get Together
Ort: Masala Rasoi, Rudolf-Breitscheid-Straße 34, Potsdam
Donnerstag, 28. September 2023
8:30 – 9:00 Uhr: Anmeldung & Kaffee
9:00 – 9:15 Uhr: Begrüßung
Ort: Wissenschaftsetage im Bildungsforum, Am Kanal 47, 14467 Potsdam, Seminarraum Süring + Volmer9:15 – 10:45 Uhr: Panel Forschung mit vulnerablen Zielgruppen
Ort: Seminarraum Süring + Volmer
Chair: Elena Link10:45 – 11:15 Uhr: Pause
11:15 – 12:45 Uhr: Panel Ethische Herausforderungen standardisierter Forschungsdesigns
Ort: Seminarraum Süring + Volmer
Chair: Daniela Schlütz12:45 – 13:00 Uhr: Buchvorstellung Computational Methods
Ort: Seminarraum Süring + Volmer
Chair: Jakob Jünger13:00 – 14:30 Uhr: Mittagessen
14:30 – 15:30 Uhr: Offenes Panel
Ort: Seminarraum Süring + Volmer
Chair: Julia Niemann-Lenz15:30 – 16:00 Uhr: Pause
16:00 – 17:00 Uhr: Interaktive Workshops
Workshop 1: No risk, no findings: Ethische Herausforderungen in der Forschung zu Inzivilität und Hate Speech online
Ort: Seminarraum Süring + Vollmer
Workshop 2: Auf Augenhöhe? Ethische Herausforderungen in der Forschung mit vulnerablen Gruppen
Ort: Seminarraum Gundling
Workshop 3: Forschungsethik im Codierprozess der manuellen Inhaltsanalyse
Ort: Seminarraum Schwarzschild17:00 – 17:15 Uhr: Pause
17:15 – 18:30 Uhr: Fachgruppensitzung
Ort: Seminarraum Süring + Volmer
Chair: Emese Domahidi19:00 – 22:00 Uhr: Tagungsdinner
Ort: Genusswerkstatt Potsdam, Breite Straße 1A, 14467 Potsdam
Freitag, 29. September 2023
8:30 – 9:00 Uhr: Anmeldung & Kaffee
9:00 – 10:30 Uhr: Lazarsfeld-Stipendien / Offenes Panel
Ort: Seminarraum Süring + Volmer
Chair: Jens Vogelgesang10:30 – 11:00 Uhr: Pause
11:00 – 12:30 Uhr: Panel Privatheit, Partizipation und Inklusion
Ort: Seminarraum Süring + Volmer
Chair: Wiebke Möhring12:30 – 12:45 Uhr: Verabschiedung
Ort: Seminarraum Süring + Volmer13:00 Uhr: Ende der Tagung
Workshop des Mittelbaunetzwerks Methoden
Im Vorfeld der Tagung finden zwei Workshops des Mittelbaunetzwerkes statt.
Ort: Medieninnovationszentrum Babelsberg (MIZ), Stahnsdorfer Str. 107, 14482 Potsdam, Raum 1-01
Workshop 1: Forschungsethik in der Lehre. Ein Blick auf Integrationsmöglichkeiten und didaktische Tools
Mittwoch, 27. September 12:30-14:00 Uhr
Leitung: Eva-Maria Roehse (TU Dortmund), Wiebke Möhring (TU Dortmund), Arne Freya Zillich (Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF), Daniela Schlütz (Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF), Elena Link (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Forschungsethik – verstanden als der respektvolle und wertschätzende Umgang mit allen an
empirischen Forschungsprojekten beteiligten Personen – ist ein wesentlicher Bestandteil guter
wissenschaftlicher Praxis. In der Kommunikations- und Medienwissenschaft (KMW) gewinnt das Thema zunehmend an Bedeutung. Ein Grund dafür ist, dass die Forschungsgegenstände der KMW (z. B. digitale öffentliche Kommunikation) ebenso wie ihre Forschungsmethoden einem stetigen Wandel unterworfen sind und zunehmend komplexer werden. Dadurch entstehen neue (forschungs)ethische Herausforderungen, die auch in der Methodenausbildung thematisiert werden sollten. Im BMBF-geförderten Verbundprojekt „Forschungsethik in der Kommunikations- und Medienwissenschaft“ (FeKoM) wurden zu diesem Zweck Anknüpfungspunkte in der Methodenausbildung herausgearbeitet, Foliensätze erstellt sowie bereits bestehende Lehrmaterialien und Online-Tools gesichtet und ausprobiert.
Der Workshop bietet eine Einführung in die verschiedenen Möglichkeiten, das Thema Forschungsethik in die eigene Lehre zu integrieren und Lehrmaterialen in Vorlesungen und/oder Seminaren einzusetzen. Die Teilnehmenden werden zudem selbst verschiedene Übungen und didaktische Tools für die Lehre ausprobieren und evaluieren. So können sie zum Bespiel eine eigene Schaden-Nutzen-Abwägung anhand verschiedener Szenarien durchführen oder das Dilemma Game testen. Der Workshop richtet sich sowohl an Forschende, die eher am Anfang ihrer Lehrtätigkeit stehen, aber auch an erfahrene Lehrende, die am Thema interessiert oder vielleicht schon eigene Lehrerfahrungen zu dem Thema mit einbringen können.
Für den praktischen Teil des Workshops wäre es hilfreich, wenn die Teilnehmenden die Dilemma Game App auf ihrem Smartphone installieren.
Workshop 2: Einführung in plattformübergreifende Forschungsdesigns mit Digital Trace Data. Mit Hands-on Workshop zur Datenerhebung mit der Telegram-API
Mittwoch, 27. September 14:30-17:30 Uhr
Leitung: Kilian Bühling, Freie Universität Berlin
Durch die zunehmende Verlagerung öffentlicher und privater Kommunikation auf digitale Plattformen werden große Datenmengen erzeugt, die als Digital Trace Data bezeichnet werden. Diese digitalen Fußabdrücke bieten wertvolle Einblicke in menschliches Verhalten, soziale Interaktionen und Kommunikationsmuster. Für die Kommunikationswissenschaft hat dieses umfangreiche Datenreservoir digitaler Spuren großes Potenzial und bietet Forscher*innen die Möglichkeit, digitale Kommunikation in großem Maßstab zu untersuchen und zu verstehen. Durch die Analyse von Digital Trace Data können Kommunikationswissenschaftler*innen Trends aufdecken, Medienwirkungen messen und ein tieferes Verständnis von Kommunikationsdynamiken gewinnen, die unsere digitale Gesellschaft prägen.
Der Workshop bietet eine Einführung in plattformübergreifende Forschungsdesigns, die auf Digital Trace Data basieren. Die Teilnehmer*innen werden lernen, wie sie einen Forschungsprozess aufbauen können, der sozialwissenschaftliche Konzepte mit verfügbaren Daten verbindet. Ebenfalls werden typische Zugangswege zur Datenerhebung sowie häufige Fallstricke bei der Verwendung dieser Daten erörtert. Diese theoretischen Überlegungen werden durch ein praktisches Tutorial zur Datenerhebung über die Telegram-API begleitet, das auch die deskriptive Analyse der gesammelten Daten umfasst.
Anmeldung
Zur Anmeldung geht es hier
Der Tagungsbeitrag für Teilnehmende auf halben Stellen beträgt 40 EUR.
Der Tagungsbeitrag für Teilnehmende, die eine Stelle mit mehr als 50 Prozent innehaben, beträgt 60 EUR.
Tagungsort
- Wissenschaftsetage im Bildungsforum, Am Kanal 47, 14467 Potsdam
Die Wissenschaftsetage im Bildungsforum ist das Forschungsfenster der Wissenschaft Potsdams und Brandenburgs mitten in der Landeshauptstadt, in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Landtag. Mit der Gründung des Vereins proWissen Potsdam wurde von der Landeshauptstadt in engem Schulterschluss mit über 30 wissenschaftlichen Einrichtungen und der IHK Potsdam ein Netzwerk geschaffen, das sich der gemeinsamen Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte an ein breites Publikum widmet. Mit der Wissenschaftsetage, die in der 4. Etage des Bildungsforums Potsdam ist, bekommt diese Arbeit ihr räumliches Dach.

Anreise
- Mit der Bahn
Der Hauptbahnhof Potsdam ist durch Tram und Bus an das öffentliche Nahverkehrsnetz angeschlossen. Die Fahrtzeit vom Hauptbahnhof zur Wissenschaftsetage beträgt ca. fünf Minuten (Haltestelle "Platz der Einheit/ Bildungsforum", Tram 93, Tram 94, Tram 99, Bus 692). Zu Fuß gelangt man in ca. 15 Minuten vom Hauptbahnhof dorthin.
- Mit dem Auto
Sie erreichen das Bildungsforum über die A115: Ausfahrt Potsdam-Babelsberg Richtung Potsdam Zentrum, Nuthestraße, Berliner Straße, Am Kanal.
Mit dem Flugzeug
Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) liegt etwa 55 Kilometer östlich von Potsdam. Vom Flughafen verkehrt der Bus BER2 zum Hauptbahnhof Potsdam. Die Fahrtzeit beträgt ca. eine Stunde.
Unterkunft
Der Tagungsort sowie die Veranstaltungsorte des Rahmenprogramms liegen allesamt im Zentrum Potsdams und sind einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Es gibt kein spezielles Hotelkontingent für die Konferenz. In der Nähe des Tagungsortes gibt es mehrere Hotels in unterschiedlichen Preisklassen, die über die gängigen Online-Buchungswebsites reserviert werden können:
Lindenstraße 28/29, 14467 Potsdam
Ca. 9 Minuten zu Fuß zum Bildungsforum
Einzelzimmer ab 105 Euro / Nacht inkl. Frühstück, Doppelzimmer ab 160 Euro / Nacht inkl. Frühstück
Lange Brücke, 14467 Potsdam
Ca. 7 Minuten zu Fuß zum Bildungsforum
Einzelzimmer ab 160 Euro / Nacht exkl. Frühstück, Doppelzimmer ab 175 Euro / Nacht exkl. Frühstück
Dortustraße 9-10, 14467 Potsdam
Ca. 10 Minuten zu Fuß zum Bildungsforum
Einzelzimmer ab 95 Euro / Nacht inkl. Frühstück, Doppelzimmer ab 135 Euro / Nacht inkl. Frühstück
Babelsberger Straße 24, 14473 Potsdam (in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs)
Ca. 15 Minuten zu Fuß zum Bildungsforum
Einzelzimmer ab 67 Euro / Nacht exkl. Frühstück, Doppelzimmer ab 76 Euro / Nacht exkl. Frühstück
Rudolf-Breitscheid-Str. 63, 14482 Potsdam
Ca. 10 Minuten mit der Tram zum Bildungsforum
Einzelzimmer ab 69 Euro / Nacht exkl. Frühstück, Doppelzimmer ab 79 Euro / Nacht exkl. Frühstück
Kontakt
Prof. Dr. Daniela Schlützweitere Informationen: Prof. Dr. Daniela Schlütz Vizepräsidentin für Forschung und Transfer | Professorin für Theorie und Empirie der digitalen Medien
Raum 1310d.schluetz(at)filmuniversitaet.de
Nähere Informationen zum BMBF-geförderten Projekt „Forschungsethik in der Kommunikations- und Medienwissenschaft“ (FeKoM) finden Sie hier.