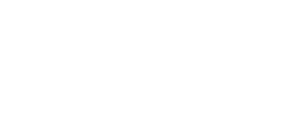Summer School "Film und immersive Medien in der Erinnerungsarbeit"

Wie erzählen wir Geschichte? Wie prägen audiovisuelle Medien die Erinnerung an Holocaust und Shoa? In der Summer School zeigen wir, wie sich Film und immersive Medien als digitaler Zugang zur Vergangenheit verstehen lassen und laden dazu ein, gemeinsam zu reflektieren, wie sie Erinnerungsarbeit prägen, Geschichte lebendig werden lassen und innovative Vermittlungsmöglichkeiten bieten.
| Kurstermin: 04.-07.09.2023 | Teilnehmendenzahl: max. 18 Personen |
| Veranstaltungsort: Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF | Zielgruppe: Gedenkstättenmitarbeiter*innen und Multiplikator*innen der politischen Bildungsarbeit, Nachwuchswissenschaftler*innen sowie Akteur*innen der Filmbildung oder Mitarbeiter*innen aus dem Museumskontext und Archiven |
| Sprache: Deutsch | Bewerbungsfrist: 21.07.2023 (Teilnahme kostenlos) |
Die Diskussion über angemessene Formen der Darstellung des Undarstellbaren ist auch fast 80 Jahre nach Kriegsende nicht abgeschlossen. Noch immer suchen Filme nach zeitgemäßen und neuen Wegen, sich mit der Shoah und dem Nationalsozialismus, wie auch deren Nachwirken, Erinnerungen und Überlieferungen, auseinanderzusetzen. Mit dem Aufkommen neuer, audiovisueller Medien bieten sich weitere vielfältige Möglichkeiten der Darstellung und Repräsentation von Geschichte, die frühere Formen aufgreifen und transformieren oder im Kontext digitaler Erzählweisen neu denken.
Welche Potenziale, aber auch Schwierigkeiten folgen daraus für die unterschiedlichen Akteur*innen und Institutionen in der Ausgestaltung von Erinnerungsarbeit?
Die Bewerbungsfrist für 2023 ist abgelaufen. Die Projektdokumentation von 2023 kann hier (PDF) runtergeladen werden. Die nächste Summer School findet vom 9. bis 12. September 2024 statt.
Inhalt
Die viertägige Summer School widmet sich anhand verschiedener Themenschwerpunkte diesen Fragen und beleuchtet, wie wir uns mit Geschichte audiovisuell auseinandersetzen und Zeitzeugnisse im digitalen Raum erfahrbar und vermittelbar machen können. Dabei setzen Referent*innen in theoretischen Inputs und Vorträgen den wissenschaftlichen Rahmen zur Auseinandersetzung mit medialer Erinnerung. Daneben werden konkrete Technologien und Projekte vorgestellt, die an der Filmuniversität und im deutschsprachigen Raum angesiedelt sind. In praxisorientierten Workshops und Gesprächen wird die eigene Perspektive auf die Geschichte reflektiert und diskutiert, wie Film und immersive Medien in die eigene Praxis integriert werden kann. Verschiedene Filmvorführungen bieten zudem Raum zur diskursiven Auseinandersetzung mit Erinnerungsperspektiven und (Grenz-)Erfahrungen. Diese Screenings werden zum Teil von Filmgesprächen mit den Filmschaffenden begleitet.
Themen
- Zeugenschaft und Tradierung
- Quellen und Archive
- Storytelling und Fiktion
Ziele der Summer School
- Einblick in aktuelle Vermittlungsprojekte, die verschiedene digitale Medien und Technologien nutzen, um Geschichte immersiv erfahrbar zu machen
- Besuch des CX-Studios der Filmuniversität
- Erwerb von technologischen und medienästhetischen Grundlagenkenntnissen für die (Weiter-)Entwicklung eigener, praxisorientierter Vermittlungsangebote
- Austausch und Gespräche mit einschlägigen Expert*innen, Wissenschaftler*innen und Forscher*innen aus dem Bereich
Programm
Montag, 04.09.2023 - Zukunft der Zeug*innenschaft
| ab 08:40 Uhr | Registrierung |
| 09:00-11:00 Uhr | Begrüßung Input von Dr. Tobias Ebbrecht-Hartmann (The Hebrew University of Jerusalem) Roundtable
Moderation: Dr. Tobias Ebbrecht-Hartmann |
| Pause | |
| 11:15-12:00 Uhr | Diskussion in Kleingruppen |
| 12:00-12:30 Uhr | Vorstellung der Nachmittagsworkshops |
| Mittagspause | |
| 14:00-15:45 Uhr | Workshops
|
| Pause | |
| 16:15-17:15 Uhr | Künstlerische Perspektiven - Gespräch unter Filmschaffenden
Moderation: Tatiana Brandrup |
| 17:30-18:30 Uhr | Gedankensammlung Was nehmen wir aus der Auseinandersetzung mit digitalen Zeitzeugnissen mit in unsere Praxis? |
| 20:00 Uhr | Abendveranstaltung Vorführung von Filmen zum Thema Zeugenschaft |
Dienstag, 05.09.2023 - Authentizität und Erfahrung
| 09:00-10:30 Uhr | Begrüßung Input von Prof. Dr.Miriam Rürup (Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrum) Roundtable
Moderation: Swantje Bahnsen (Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen) |
| 11:00-11:30 Uhr | Workshopvorstellung |
| Pause | |
| 11:30-13:00 Uhr | Workshops
|
| Mittagspause | |
| 14:30-16:30 Uhr | Erfahrungsdifferenz und Erinnerung Filmvorführung
|
| Pause | |
| 17:00-18:00 Uhr | Gedankensammlung Was nehmen wir aus der Auseinandersetzung mit Medialität, Authentizität und Erfahrung mit in unsere Praxis? |
Mittwoch, 06.09.2023 - Erinnerungsperspektiven & Multiperspektivität
| 09:00-10:30 Uhr | Input vonCornelia Siebeck (Historikerin, Hamburg, Deutschland) Roundtable
Moderation: Lea Wohl von Haselberg |
| Pause | |
| 11:00-12:00 Uhr | Diskussion in Kleingruppen |
| 12:00-12:30 Uhr | Vorstellung der Nachmittagsworkshops |
| Mittagspause | |
| 14:00-17:00 Uhr | Workshops
|
| Pause | |
| 17:30-18:30 Uhr | Gedankensammlung Was nehmen wir aus der Auseinandersetzung mit Multidirektionalität und der Vielschichtigkeit und Multiperspektivität von Erinnerung mit in unsere Praxis? |
| ab 18:30 Uhr | Empfang im Filmriss |
| 19:30 - 21:00 Uhr | Erinnerung in der postmigrantischen Gesellschaft: Perspektiven, Koalitionen, Hindernisse Podiumsgespräch mit Ulf Aminde und Lea Wohl von Haselberg in Kooperation mit der Coalition for Pluralistic Public Discourse |
Donnerstag, 07.09.2023 - Was bedeutet (mediale) Aufarbeitung der Vergangenheit? (Projektplanung & Vermittlung)
| 09:30-10:00 Uhr | Kaffee |
| 10:00-11:00 Uhr | Input 1: Planung und Umsetzung digitaler Erinnerungsprojekte - Erfahrungen und Herausforderungen mit Swantje Bahnsen, Bettina Loppe (SPUR.lab) Input 2: Planung und Umsetzung einer digitalen Plattform mit Daniel Burckhardt Input 3:Förderung von digitalen Erinnerungsprojekten Alfred Landecker Foundation mit Miriam Menzel Input 4: Förderung von digitalen Erinnerungsprojekte Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft mit Leonore Martin |
| 11:15-12:30 Uhr | Expert*innentische |
| Mittagspause | |
| 14:00-14:30 Uhr | Workshopvorstellung |
| 14:30-16:30 Uhr | Workshops
|
| Pause | |
| 16:45-17:30 Uhr | Abschluss der Veranstaltung & Evaluation Was nehmen wir aus der Auseinandersetzung mit digitalen Formen der Erinnerung an Holocaust und NS-Geschichte mit in unsere Praxis? |
Inhaltlich-wissenschaftliches Team

Dr. Lea Wohl von Haselberg

Tatiana Brandrup

Dr. Tobias Ebbrecht-Hartmann

Julia Kleinschmidt
Referent*innen (A-B)
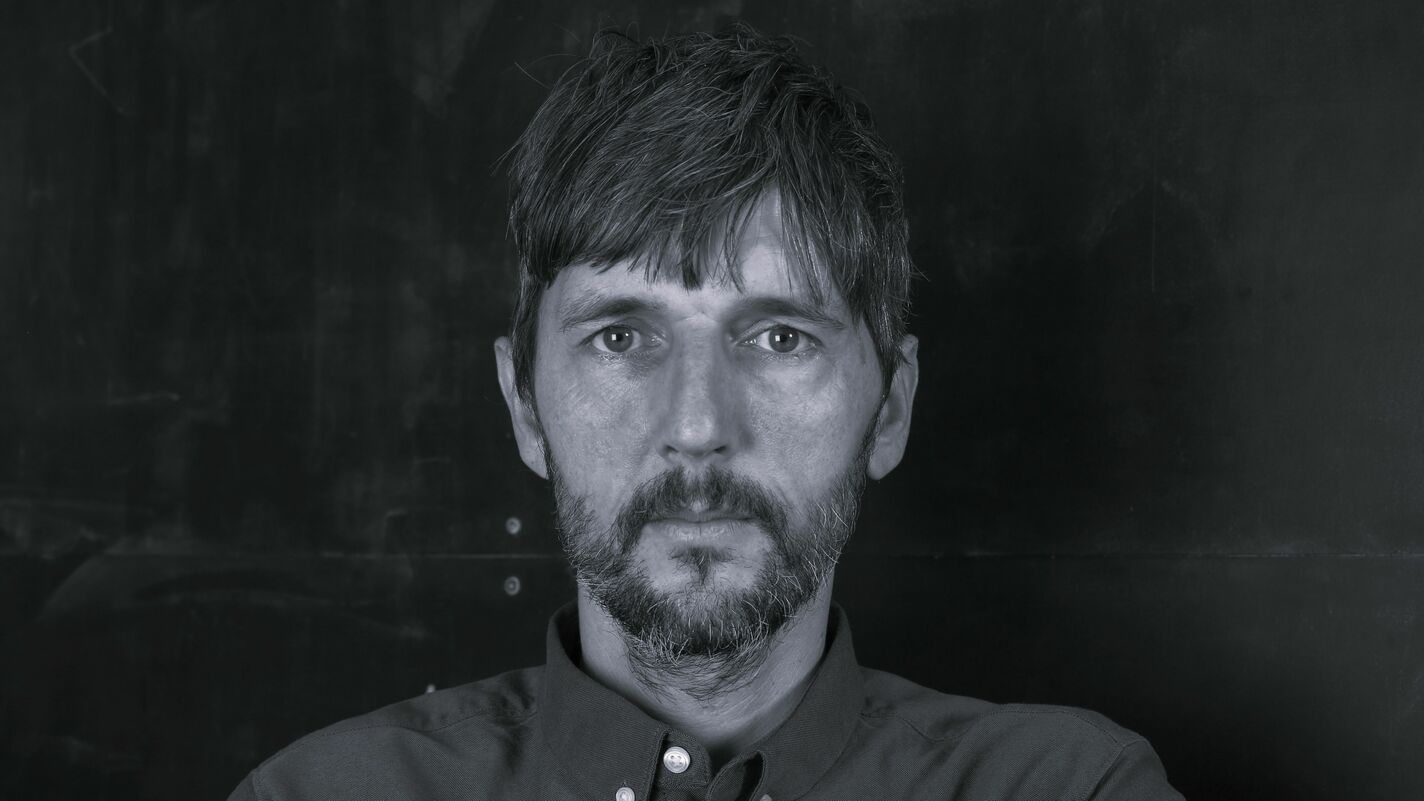
Ulf Aminde

Swantje Bahnsen (r.)

Kaya Behkalam, Ph.D.
Referent*innen (B-D)

Daniel Burckhardt

Hamze Bytyçi

Prof. Dr. Axel Drecoll
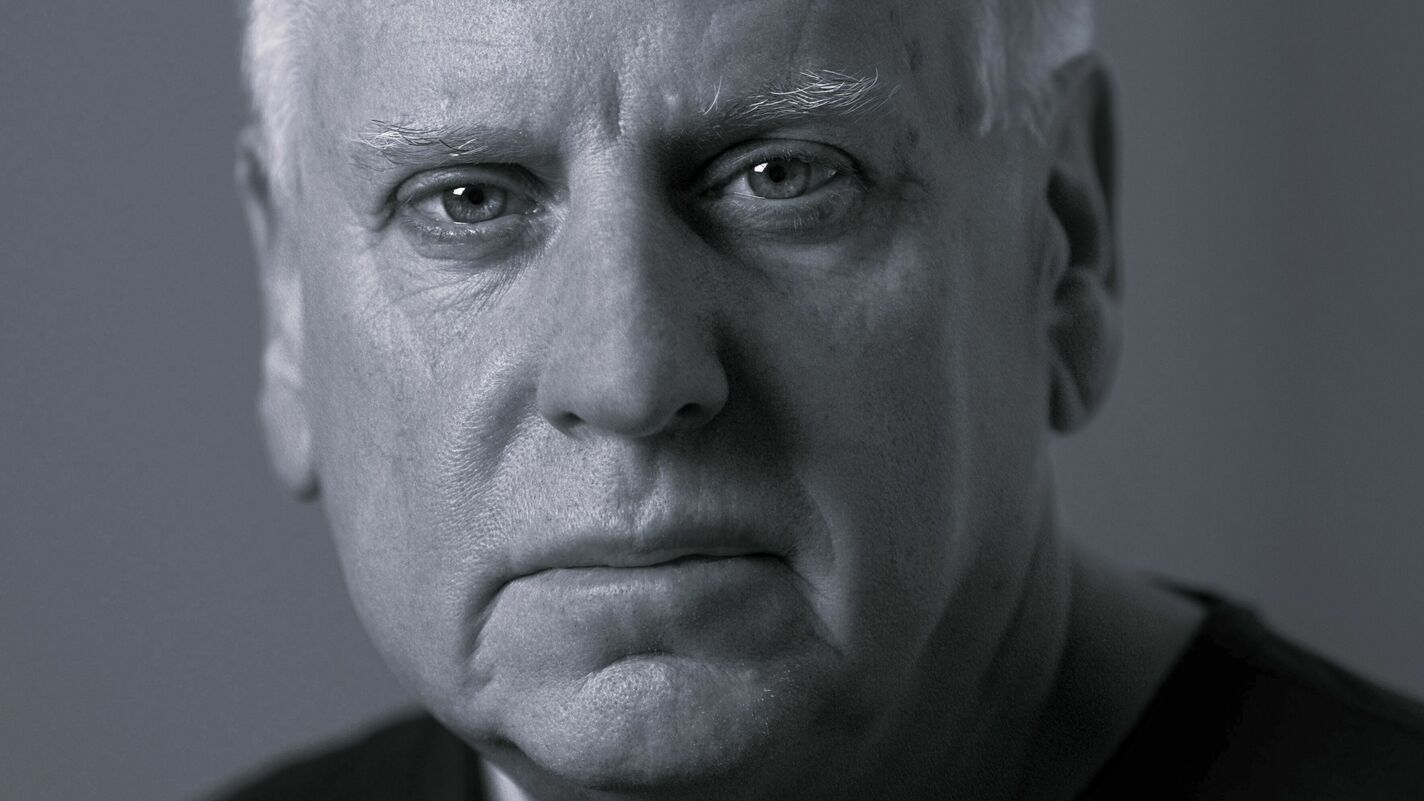
Arnold Dreyblatt
Referent*innen (G-L)

Jonathan Guggenberger

Beate Hetényi

Matthias Heyl

PD Dr. Eva Lezzi
Referent*innen (L-P)

Bettina Loppe (l.)

Leonore Martin

Miriam Menzel

Cord Pagenstecher
Referent*innen (P-S)

Dr. Ralf Possekel

Katja Pratschke und Gusztáv Hámos

Prof. Dr. Miriam Rürup

Cornelia Siebeck
Referent*innen (Z)

Nina Zellerhoff

Christian Zipfel
Bewerbung & Teilnahme
Die Summer School wendet sich vorrangig an Gedenkstättenmitarbeiter*innen und Multiplikator*innen der politischen Bildungsarbeit, Nachwuchswissenschaftler*innen sowie Akteur*innen der Filmbildung oder Mitarbeiter*innen aus dem Museumskontext und Archiven.
Die Bewerbung erfolgt online über unser Anmeldeformular unter der Angabe folgender Informationen:
- Name der teilnehmenden Person
- Kontaktdaten und Email-Adresse
- Name der Institution und Position
- Kurze Motivation der Teilnahme und Bezug zur eigenen Praxis, ggf. mit Links (ca. 500 Wörter)
Bewerbungsfrist: 21. Juli 2023. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt. Zusagen erfolgen bis zum 1. August 2023.
Kosten
Die Teilnahme ist kostenlos. Im Programm inbegriffen sind Mittagessen sowie Kaffee und Snacks. Reisekosten müssen von den Teilnehmer*innen selbst getragen werden. Hotelzimmer können auf Anfragen in begrenztem Umfang kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Bitte geben Sie den Bedarf bei der Bewerbung unter Anmerkungen an.
Gerne stellen wir auch Hinweise für Unterkünfte in der Nähe zur Verfügung.

Die Summer School “Film und immersive Medien in der Erinnerungsarbeit” wird in Zusammenarbeit mit dem Moses-Mendelssohn-Zentrum der Universität Potsdam veranstaltet, durch den Fonds für Forschung und Transfer der Filmuniversität und das interdisziplinäre Forschungslabor SPUR.lab (gefördert im Programm Kultur Digital der Kulturstiftung des Bundes) unterstützt und gefördert durch die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) sowie dem Brandenburgische Zentrum für Medienwissenschaften (ZeM). Das Podiumsgespräch „Erinnerung in der Postmigrantischen Gesellschaft“ wird freundlicherweise unterstützt von Coalition for Pluralistic Public Discourse (CPPD).