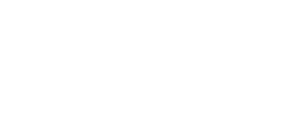Kaspar 2028 ist ein hybrides Theaterprojekt zur künstlerischen Erforschung generativer KI, das am Residenztheater München in Kooperation mit der Filmuniversität Babelsberg entsteht. Das Projekt integriert generative KI (GenAI) als Spiel- und Bildpartner:in in den theatralen Schaffensprozess und gestaltet damit Peter Handkes Bühnentext «Kaspar» (1968) neu. Mit digitaldramaturgischen Methoden wird die Ethik und Ästhetik des KI-basierten «Klonens» von menschlichen Körpern, Texten, Stimmen und Umgebungen und deren kreativ-disruptives Potenzial für die Künste untersucht.
In Zusammenarbeit des Regisseurs Manuel Hendry und des Digitaldramaturgen Ilja Mirsky wird 2028 am Residenztheater eine multimediale Neuinszenierung von Peter Handkes Sprechstück „Kaspar“ (1968) entstehen. Die Filmuniversität ist unter Leitung von Lena Gieseke als Spiel- und Bildpartner:in für die die Entwicklung eines KI-Systems verantwortlich, welches als Forschungsprojekt in das CX Studio integriert wird. Als eines von insgesamt elf Projekte wurde „Kaspar 2028 von der Kulturstiftung des Bundes im Programm „Kunst und KI“ zur Förderung ausgewählt.
«Kaspar» ist ein Stück der Sprachkritik, von Handke selbst als «Sprachfolter» bezeichnet. Konfrontiert mit eloquenten Doppelgängern und überspült von Befehlen kämpft die von Kaspar Hauser inspirierte Titelfigur um ihre Individualität – und scheitert. 1968 revoltierte Handke mit seinem Text gegen eine autoritäre Gesellschaft, die uns in tradierte Formen presst. Heute stammen diese Formen aus dem Cyberspace. Nicht der Untertan, sondern fröhliche Konsumierende sind das Ideal – angefüttert mit Optimierungsversprechungen und normativen Texten und Bildern, oft aus der Feder einer KI. Handkes Text erinnert verblüffend an ChatGPT und die magisch-irritierende Natur maschinen-generierter Sprache und Sprechens. Während in Handkes Universum Macht und Widerstand nur als Männerbilder denkbar waren, legen wir eine tänzerische, dediziert physische Interpretation der Rolle des «Kaspar» vor, besetzt mit einer androgynen Persönlichkeit, deren geschlechtliche Identität sich im Verlauf des Stücks stetig wandelt.
Um diese Irritationen künstlerisch zu erkunden, entwickeln wir das KI-System Kaspar.ai (K.ai). Kaspars Darsteller:in wird mit K.ai in Aussehen und Stimme digital geklont und steht sich damit selbst – im Proberaum wie auf der Bühne – als digitale:r Spielpartner:in (und Gegner:in) zur Verfügung. Für K.ai entwickeln wir Fähigkeiten zum Spiel nach Vorgaben der Regie und zur interaktiven, von der Maschine generierten Improvisation. Das doppelgängerische Erscheinungsbild beginnt beim Realismus und wird kontinuierlich zu albtraumartigen Gebilden verfremdet.
Im Zentrum unserer Untersuchung stehen Potenzialen und Herausforderungen der Integration von Generativer KI in theatrale und virtuelle Produktionsprozesse. Wir fragen: Welche neuen Spielformen entstehen, wenn Spielende mit ihrem virtuellen Selbst oder mit anderen KI-generierten Figuren in Dialog treten? Dabei interessiert uns insbesondere, welche ethischen und psychologischen Konflikte in solchen Konstellationen auftreten können. Zugleich wollen wir untersuchen, mit welchen Techniken und Ästhetiken sich GenAI-basierte und cineastische Praktiken – insbesondere im Kontext von Virtual Production – künstlerisch gewinnbringend in theatrale Produktionsabläufe integrieren lassen. Ein zentrales Anliegen ist es zudem, wie wir Künstler:innen mit GenAI ermächtigen können, anstatt sie durch deren Einsatz zu marginalisieren oder auszubeuten. Schließlich stellt sich die Frage, was mit den digitalen Repräsentationen – etwa dem Digitalisat von Kaspar – nach dem Produktionsende geschieht: Wem gehören diese Daten, und welche Verantwortung geht mit ihrer weiteren Nutzung einher?
Aus diesen Fragestellung ergibt sich als Ziel des Vorhabens, einen öffentlichen und kritischen Diskurs über Generative KI, die zunehmende Auflösung der Grenze zwischen analoger und digitaler Welt sowie deren gesellschaftspolitische Konsequenzen anzuregen. Dabei soll insbesondere das Verständnis und die Handlungsfähigkeit von Kunstschaffenden und der breiten Öffentlichkeit gestärkt werden – auch für ein technikfernes Publikum – durch zugängliche, ästhetisch erfahrbare Formen des Umgangs mit GenAI. Darüber hinaus zielt das Projekt auf einen nachhaltigen Wissens- und Technologietransfer ab: von künstlerischer Praxis hin zu Kulturinstitutionen sowie zu Entscheidungsträger:innen in Politik und Wirtschaft.
“Ich freue mich auf Kaspar 2028, weil das Projekt nicht nur neue ästhetische Spielräume eröffnet, sondern zugleich eine kritische Auseinandersetzung mit Macht, Kontrolle und kreativer Autonomie im Zeitalter generativer Systeme anstößt. Im Zentrum steht für mich die Frage, wie wir Technologie so gestalten können, dass sie menschliche Künstler:innen stärkt – nicht ersetzt.“
—Lena Gieseke
“Während eine Probenphase im Theater üblicherweise sechs bis acht Wochen umfasst, freue ich mich außerordentlich, dass mit Kaspar 2028 in einem zweijährigen Entwicklungs- und künstlerischen Forschungsprojekt die Chance entsteht, wirklich Neues zu schaffen. Dieses Vorhaben eröffnet das Potential für technologisch geprägte Inszenierungen, in denen sich künstlerische und technologische Konzepte auf innovative und tiefgreifende Weise ineinander verweben.“
— Ilja Mirsky
“Mit Kaspar 2028 etablieren das Theater als Labor, in dem wir eine neue, kollaborative Technikkultur erproben. Wir wollen Künstlerinnen und Künstlern Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie die digitalen Mächte, die unsere Welt formen, spielerisch, kritisch und subversiv befragen können.“
— Manuel Flurin Hendry
Zur Meldung auf der Seite der Kulturstiftung des Bundes.