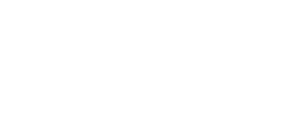Referent*innen
Kaya Behkalam, Ph.D.
Kaya Behkalam lebt als Künstler, Autor und Kurator in Berlin. In seinen medienarchäologischen Arbeiten forscht er an Formen digitalen Gedenkens und nonlinearen und topografischen Erzählweisen. Promotion an der Bauhaus Universität Weimar, zuvor Studium der Medienkunst an der Universität der Künste Berlin. Seine künstlerischen Arbeiten wurden unter anderem im Haus der Kulturen der Welt gezeigt, der Berlinischen Galerie, Martin-Gropius-Bau, Queens Museum New York, Reina Sofia Madrid, Kunstverein Heidelberg, 3. Guangzhou Triennial und IDFA Amsterdam. Seit 2018 ist er Direktor des Kunstvereins Künstlerhof Frohnau e.V., seit 2021 ist er künstlerischer Experte im Projekt SPUR.lab.

Tobias Ebbrecht-Hartmann
Tobias Ebbrecht-Hartmann unterrichtet an der Hebräischen Universität in Jerusalem Filmgeschichte, deutsche Kulturgeschichte und Erinnerungskulturgeschichte. Er publiziert zu filmischer und digitaler Erinnerung an den Holocaust sowie den Umgang mit historischem Filmmaterial. Er ist Autor von „Geschichtsbilder im medialen Gedächtnis: Filmische Narrationen des Holocaust“ (Bielefeld, 2011) und Mitglied im Konsortium des Horizon Europe Projekts “MEMORISE: Virtualisation and Multimodal Exploration of Heritage on Nazi Persecution”. Er is wissenschaftlicher Experte im Projekt SPUR.lab und war Teil des Horizon 2020 Peojekts “Visual History of the Holocaust: Rethinking Curation in the Digital Age”.

Dr. Ralf Possekel
Dr. Ralf Possekel, geb. 1961, ist Leiter des Bereichs Förderung und Aktivitäten der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. In der Stiftung arbeitet er seit 2000. Er ist Historiker und hat in den 90er Jahren zur Geschichte der Geschichtswissenschaft, zur Geschichte der Intellektuellen in der DDR und zur Geschichte der Entnazifizierung in der sowjetischen Besatzungszone publiziert. Im Rahmen seiner Stiftungstätigkeit spricht er u.a. zu den Themen: Geschichte der Auszahlungen an ehemalige Zwangsarbeiter:innen durch die Stiftung EVZ; die deutsche Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen als eine Form von Transitional Justice; die Erinnerungskultur in Deutschland und Mittel- und Osteuropa. Ralf Possekel ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen, hat 1984 die Moskauer Lomonossow-Universität als Diplomhistoriker abgeschlossen und 1990 zu geschichtstheoretischen Fragen an der Akademie der Wissenschaften der DDR promoviert.

Christian Zipfel
Christian Zipfel ist Autor, Editor und Regisseur-Regiestudium Filmschule in Köln 2012 bis 2016 und 2016 bis 2020 an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Nominierung für den First Steps Award im Jahr 2016. Er erhielt das Wim Wenders Stipendium für sein Projekt "Pestizid" von 2020 bis 2022. Darüber hinaus wurde er 2018 für den Schwarzen Löwen bei den 75. Filmfestspielen von Venedig nominiert.

Julian Vogel
Julian ist 1985 in Frankfurt am Main geboren und hat an der FU Berlin, der Filmakademie Baden-Württemberg und der Fémis in Paris studiert. Er macht Dokumentarfilme. Manchmal gibt er auch Film-Workshops oder arbeitet als Journalist. Er hat einen Film über einen Freier gemacht, der sich in eine Prostituierte verliebt (TILMAN IM PARADIES, 2011), einen Film über Bewohner und Planer eines Plattenbaus (PALAST, 2013) und einen Film über den verstorbenen Vater seines besten Freundes (BILDER VOM FLO, 2016). 2023 erscheint seine Dokumentar-Trilogie EINZELTÄTER, die sich Menschen widmet, die Angehörige bei rechtsextremen Anschlägen verloren haben. Die Reihe wird mit dem Hessischen Filmpreis, dem Preis der Duisburger Filmwoche und dem Grimmepreis ausgezeichnet. 2023 gründet Julian die Produktionsfirma patatino.

Prof. Dr. Michael Wachholz
Michael Wachholz ist Dozent für Politologie und Holocaust Studies am CIEE Global Institute Berlin und freier Mitarbeiter an der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannseekonferenz mit Bildungsveranstaltungen und Seminaren zu verschiedenen Aspekten der NS-Geschichte. Zuvor und zum Teil zeitgleich unterrichtete er an der Touro University Berlin amerikanische Politik und Geschichte sowie Holocaust-Literatur. Beginn der professionellen Beschäftigung mit dem Thema deutscher Faschismus und Holocaust war seine Tätigkeit als Researcher und Co-Produzent einer amerikanischen Dokumentarfilmproduktion. Es entstand u.a. ein Film über Ravensbrück und Sachsenhausen. Michael Wachholz promovierte über postmoderne Geschichtstheorie am John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien der FU Berlin nach einem Studium an der Howard University, einer historically Black university in Washington D.C.

Yael Reuveny
Yael Reuveny machte 2005 ihren Abschluss an der Sam Spiegel Film School in Jerusalem. Seitdem arbeitet sie zwischen Israel und Deutschland. Zu ihren Filmen gehören "Schnee von gestern" (2013) und "Kinder der Hoffnung" (2021).
Parallel zu ihrer Arbeit als Dokumentarfilmerin entwickelt und produziert Yael auch Museums-Video-Installationen, darunter "Tunicata" (2017, Martin-Gropius-Bau Berlin), "Mesubin" (2020, Kernausstellung Jüdisches Museum Berlin) und kürzlich "Neuland" (2023), eine 8-Spur Audio-Video-Installation für die Ausstellung "Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR" im Jüdischen Museum Berlin.
Yael ist derzeit Gastprofessorin an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf.

Hamze Bytyçi
Hamze Bytyçi ist Aktivist, Medien-und Theaterpädagoge, Regisseur und Kurator. Im Kampf gegen Antiziganismus initiierte er viele Bündnisse, Vereine und Festivals mit, u. a. Amaro Drom, den ROMADAY in Berlin, das Bündnis für Solidarität mit den Sinti und Roma Europas, LinksKanax*, die Roma-Biennale und das Roma-Filmfestival AKE DIKHEA?. Seit 2012 ist er Vorsitzender von RomaTrial. Er ist Vorstandsmitglied der ndo und Mitglied der CPPD –Coalition for Pluralistic Public Discourse.

Dr. Matthias Heyl
Matthias Heyl ist Leiter der Bildungsabteilung der Gedenkstätte Ravensbrück. Er begleitete das Projekt SPUR.lab. Seit 2002 entwickelt er mit seinem Team und Partner*innen Seminarformate, die historisch-politische mit kultureller Bildung am historischen Ort des einstigen Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück verbinden. Dazu gehören filmische Projekte mit Jugendlichen (medi@ktiv, 2002-2010), ein Druck-Projekt mit der Litfaß-Schule Berlin (Ravensdruck, seit 2010) und „Sound in the Silence“ (seit 2017) in Kooperation mit Künstler*innen um den US-amerikanischen Rapper Dan Wolf. In Art-Workshops (Rap, Dance, Sound) entstehen unterschiedliche künstlerische Auseinandersetzungsformen, die zu einer Performance zusammengeführt und sukzessive online gestellt werden. www.youtube.com/@silenceisnolongerhere/. In „Ravensbrück Voices“ erstellen Teilnehmende verschiedener Seminare unterschiedlicher Herkunft Soundfiles, in denen sie eigene Worte und eine eigene Haltung zur Geschichte der nationalsozialistischen Massenverbrechen finden. www.voices.ravensbrueck.de. So erleben sie sich als aktive Teinehmer*innen an einer lebendigen Erinnerungskultur. Heyl gehört seit 2023 dem Expert*innen-Gremium des Projekts „Let’s Remember! Erinnerungskultur mit Games vor Ort“ der Stiftung Digitale Spielekultur an.

Leonore Martin
Leonore Martin ist Fachreferentin für „Bilden in digitalen Lernräumen“ der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ). Sie ist seit 2005 in der Stiftung EVZ, Bereich Geschichte, tätig und war für zahlreiche Förderprogramme im Bereich der historisch-politischen Bildung verantwortlich. Sie brachte 2018 digital // memory mit auf den Weg. Dieses Förderprogramm der Stiftung EVZ war eins der ersten im Akteursfeld, das die Entwicklung und Erprobung digitaler Formate als Teil einer Erinnerungskultur 4.0 unterstützte – die Verbindung von digitalen Tools und Techniken mit historischen Orten und lokaler Geschichte.

Prof. Dr. Björn Stockleben
Björn Stockleben ist Professor für Emerging Media Production an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF. Seine aktuellen Forschungsinteressen umfassen KI in der Filmproduktion, Virtual Production, Cultural Heritage in XR und AR Social Serious Gaming. Er ist Co-Head des Creative Exchange Studios an der Filmuniversität und arbeitet mit seiner Forschungsgruppe in verschiedenen Projekten zur digitalen Holocaust-Erinnerungskultur, zu AR-gestütztem Krisenstabstraining und zur Neuinterpretation digitaler Cultural Heritage Archive.

Tucké Royale
Tucké Royale (geb. 1984, Quedlinburg). Autor, Regisseur, Musiker und Schauspieler. Studium der Judaistik an der FU Berlin und Puppenspielkunst an der der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch«. Seine Theaterstücke »TUCKÉ ROYALE«, »Ich beiße mir auf die Zunge und frühstücke den Belag, den meine Rabeneltern mir hinterließen« und »Mit Dolores habt ihr nicht gerechnet. Ein jüdisch-queeres Rachemusical« sind bei rua. Theaterkooperative für Text & Regie verlegt. Erster Sprecher des Zentralrats der Asozialen in Deutschland und Mitgründer von »BOIBAND«. Initiator der Gedenkfahrt »Stonewall Uckermark«. Drehbuchautor und Darsteller des Spielfilms »Neubau. Ein Heimatfilm«(Preis für gesellschaftliche Relevanz 2020, Beste Spielfilm Max Ophüls-Preis 2020, Braunschweiger Filmpreis 2020, Preis der deutschen Filmkritik 2021). Stadtschreiber von Ludwigsburg 2022. Autor der Hörspiele »The Revolution Will Be Injected« (Hörspiel des Monats Mai 2020, International Radio Grand Prix URTI Matthey-Doret Award 2021)und „Mit Dolores habt ihr nicht gerechnet“ (Hörspiel des Monats Juni 2024). In Arbeit BKM-gefördertes Drehbuch „Alman hesabı - Getrennte Rechnung“.

Katja Melzer
Katja Melzer ist in verschiedenen leitenden Kapazitäten im internationalen Kultur- und Bildungsbereich mit Schwerpunkt auf künstlerische Kooperationen und Kulturaustausch tätig. Nach dem Studium der Kunstgeschichte, Kulturwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre an der Humboldt-Universität Berlin arbeitete sie zunächst mehrere Jahre im Bereich Kulturaustausch in Ungarn und ab 2012 in Kanada mit dem inhaltlichen Fokus auf Medienkunst. Zwischen 2016 bis 2021 leitete Katja Melzer das Goethe-Institut in Montreal. Seit Oktober 2021 ist sie Geschäftsführerin der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte und Direktorin des Brandenburg Museum für Zukunft, Gegenwart und Geschichte in Potsdam.

Dan Thy Nguyen
Dan Thy Nguyen ist freier Theaterregisseur, Schauspieler, Schriftsteller und Sänger in Hamburg. Er arbeitete an diversen Produktionen u.a. In Ballhaus Naunynstraße, auf Kampnagel, dem Mousonturm Frankfurt, dem MDR und an der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. 2014 entwickelte und produzierte er das Theaterstück „Sonnenblumenhaus“ über das Pogrom von Rostock -Lichtenhagen, welches 2015 in seiner Hörspielversion die „Hörnixe“ gewonnen hat und bis heute noch an diversen Institutionen gespielt wird. Seit 2020 leitet er mit seiner Produktionsfirma Studio Marshmallow das Hamburger Festival "fluctoplasma - 96h Kunst Diskurs Diversität" und er ist stellvertretender Vorstand der LAG Kinder- und Jugendkultur Hamburg. 2021 erhielt er den Deutschen Hörspielpreis für seine schauspielerische Leistung.

Mike Robbins
Mike Robbins ist Mitbegründer von High Road Stories, einem 2018 in Berlin gegründeten Kreativstudio für immersive Erlebnisse. High Road Stories entwickelt als multidisziplinäres Team innovative digitale Projekte und leitet Produktionen in Zusammenarbeit mit einem internationalen Netzwerk talentierter Künstler.
In seinem früheren Leben studierte Mike Bildende Kunst in Toronto und war Rockmusiker. Als kreativer Technologe und Partner bei seinem Unternehmen Helios Design Labs in Toronto leitete er bahnbrechende interaktive Dokumentarfilmprojekte wie Highrise (2012, mit der Regisseurin Kat Cizek), das mit Emmy-, Peabody-, World Press Photo- und Canada Screen-Preisen ausgezeichnet wurde. Weitere Projekte umfassen das Quipu Project, Digital Me, After The Storm und Offshore.
2018 gründete er zusammen mit der Regisseurin Harmke Heezen das Unternehmen High Road Stories, das sich auf immersive Formen des Geschichtenerzählens konzentriert, wie etwa die VR-Erlebnisse The Infinite Library, Place und Fantaventura (mit den deutschen Rap-Legenden Die Fantastischen Vier). Kürzlich hat High Road Stories mit der Künstlerin Yael Bartana zusammengearbeitet, was in einer kuppelfüllenden Projektinstallation als Teil des deutschen Pavillons auf der Kunstbiennale 2024 in Venedig gipfelte. Weitere Ausstellungsorte weltweit sind die Alte Nationalgalerie in Berlin, das National Palace Museum in Taiwan, das Israel Museum in Jerusalem, das Stadtpalais in Stuttgart und das Munch Centre in Norwegen sowie internationale Filmfestivals wie CPH, IDFA und das BFI London Film Festival.

Marina Chernivsky
Marina Chernivsky ist Psychologin und Verhaltenswissenschaftlerin. Sie arbeitet, forscht und publiziert auf dem Themengebiet transgenerationales Trauma, Antisemitismus und Diskriminierung in Institutionen. Sie leitet das von ihr gegründete Kompetenzzentrum für antisemitismuskritische Bildung und Forschung in Trägerschaft der ZWST e.V., ist Gründerin sowie Geschäftsführerin von OFEK e.V. Zudem hat sie gemeinsam mit Friederike Lorenz-Sinai Bände aus der Reihe 'Antisemitismus im Kontext Schule' und 'Institutioneller Antisemitismus in der Schule' sowie „Shoah in Bildung und Erziehung“ veröffentlicht. Seit 2019 ist Marina Chernivsky Mitglied im Beratungsgremium des Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus.

Prof. Dr. Tanja Thomas
Tanja Thomas ist Professorin für Medienwissenschaft mit dem Schwerpunkt Transformationen der Medienkultur an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören u.a. Fragen zu Erinnerungskultur in der Mediengesellschaft; Medien und Migration; rechte Gewalt, Rassismus und Medien; Partizipation und Protest aus einer Gender-, Memory- und Cultural (Media) Studies Perspektive. Sie ist Miniatorin des Projektes und des gleichnamigen Podcasts „DoingMemory für eine plurale Gesellschaft“ (https://doing-memory.de). Zu den jüngsten Veröffentlichungen im Forschungsfeld gehören u.a. zwei Schwerpunkthefte der feministischen Studien mit dem Titel „Feministisches Erinnern: Politiken, Praktiken, Kämpfe“ (1/2023) sowie „Feministisches Erinnern: Kontroversen, Allianzen, Zukünfte“(2/2023).

Jörg Friedrich
Jörg Friedrich, Game Designer aus Berlin, entwickelte mit seinem Team "Through the Darkest of Times", ein preisgekröntes Spiel über zivilen Widerstand in Nazi-Deutschland. Mit über 20 Jahren Erfahrung arbeitete er zuvor an Titeln wie "Spec Ops: The Line" und "Dead Island 2".
2017 gründete er mit Sebastian St. Schulz Paintbucket Games, fokussiert auf historische und politische Spiele. Ihr zweites Spiel "Beholder 3" gewann ebenfalls Preise. Aktuell entwickeln sie "The Darkest Files" über die Aufklärung von NS-Verbrechen in den 1950ern. Neben seiner Rolle als Game Director und Geschäftsführer organisiert Friedrich Workshops über den Einsatz von Computerspielen zur Vermittlung sozialer, politischer und historischer Themen.

Dr. Mark Terkessidis
Freier Autor, arbeitet zu den Themen Migration, Rassismus, gesellschaftlicher Wandel und Erinnerung.
Studium der Psychologie in Köln, Promotion in Pädagogik in Mainz.
Redakteur der Zeitschrift „Spex“, Moderator für WDR „Funkhaus Europa“, Fellow am Piet Zwart Instituut der Willem de Kooning Akademie Rotterdam und von 2012 bis 2017 Lehrbeauftragter an der Universität St Gallen (HSG).
Zahlreiche Beiträge in „tageszeitung“, „Die Zeit“, „Süddeutsche Zeitung“, „Freitag“,„Literaturen“, „Texte zur Kunst“, etc. sowie für den „Westdeutschen Rundfunk“ und „DeutschlandFunk“.
Letzte Buchveröffentlichungen: „Interkultur“ (2010), „Kollaboration (2015, bei edition Suhrkamp), „Nach der Flucht. Neue Vorschläge für die Einwanderungsgesellschaft“ (2017, Reclam), „Wessen Erinnerung zählt. Koloniale Vergangenheit und Rassismus heute“ (2019, Hoffmann & Campe), „Das postkoloniale Klassenzimmer“ (2021, Aktion Courage); Hg. mit Natalie Bayer: „Die postkoloniale Stadt lesen. Historische Erkundungen in Friedrichshain-Kreuzberg“ (2022, Verbrecher).

Karen Jungblut
Karen Jungblut, Expertin für Oral Histories und Holocaust- sowie Genozidforschung, studierte Geschichte und Politikwissenschaften in New York und Berlin. Über 25 Jahre war sie bei der USC Shoah Foundation, die von Steven Spielberg gegründet wurde, maßgeblich am Aufbau des Visual History Archive und des „Dimensions in Testimony“-Programms beteiligt. Heute ist sie Geschäftsführerin der Digitalen ErinnerungsWerkstatt gGmbH und entwickelt Projekte, die digitale und analoge Ansätze zur Förderung der Gedenk- und Bildungsarbeit verbinden. Aktuell arbeitet sie an VR-Projekten wie „Tell me, Inge“ und der Dokumentation der Ereignisse des 7. Oktobers in Israel für „Survived to Tell“.

Lukas März
Lukas März ist Drehbuchautor und Regisseur aus München. Nach einem Germanistik- und Theaterwissenschaftsstudium in Deutschland und Italien studierte er von 2016-2022 Drehbuch an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Arbeitserfahrung sammelte er unter anderem als Mitarbeiter im internationalen Serien-Development bei Studiocanal und als Lektor für Pro7/ Sat1, Koch Media oder Maze Pictures. Seit 2020 ist er freischaffend als Drehbuchautor für deutsche und österreichische Produktionsfirmen tätig, hauptsächlich für Komödien, Historien- und Genre-Stoffe. Daneben arbeitet er als Regisseur von Kurzfilmen, Web- und Werbeformate und als Video-Artist und Dramaturg für Münchner Theater.

Jakob Saß
Jakob Saß ist Historiker in Berlin und Potsdam. Er forscht zur NS-Geschichte, zu Rechtsextremismus nach 1945 und Geschichtsdarstellungen in digitalen Spielen. Am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam beendet er zurzeit seine Dissertation zu Rechtsradikalismus in der Bundeswehr und NVA (1955-1998). Freiberuflich leitet er Fortbildungen zum Thema „Erinnerungskultur mit Games“, unter anderem im Auftrag der Stiftung digitale Spielekultur, sowie Workshops für Schüler:innen zur historisch-politischen Bildung mit digitalen Spielen.

Dr. Wenke Wegner
Dr. Wenke Wegner, geboren 1978 in Berlin, studierte in Lyon und Weimar Europäische Medienkultur. Sie promovierte 2012 mit einer Arbeit zur Filmästhetik und Vermittlung in den Filmen der Berliner Schule an der Universität Bremen. Seit vielen Jahren ist sie in der Bildung und Vermittlung im Film- und Ausstellungsbereich tätig, u.a. für die Stiftung Deutsche Kinemathek, die Schulkinowochen, die Bundeszentrale für politische Bildung und die Friedrich Ebert Stiftung.
In den letzten zwei Jahren hat sie für die Wechselausstellungen des Deutschen Historischen Museums Bildungsprogramme konzipiert und durchgeführt. Seit Anfang 2023 ist sie verantwortlich für das Vermittlungskonzept der mobilen VR-Ausstellung: „In Echt? Virtuelle Begegnungen mit NS-Zeitzeug:innen“.
Publikationen (Auswahl): «Kino, Sprache, Tanz. Ästhetik und Vermittlung in den Filmen der Berliner Schule» (2015), außerdem u.a. in den Sammelbänden: «Die ‚Filmkritik‘ und die Medien» (2024), «FilmBildung» (2014), «Frieda Grafe, 30 Filme» (Berlin, 2013), «Vom Kino lernen. Internationale Perspektiven der Filmvermittlung» (2010), «Libertas Schulze-Boysen. Filmpublizistin» (2008).

Prof. Dr. Azadeh Sharifi
Prof. Dr. Azadeh Sharifi ist seit WS 2023 Gastprofessorin im Institut für Theaterwissenschaft an der FU Berlin. Zuvor war sie DAAD-Visiting Assistant Professor am Department of Germanic Languages & Literatures der University of Toronto und Gastprofessorin an der Universität der Künste (UdK) Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind (post)koloniale und (post)migrantische Theatergeschichte, zeitgenössische Performance Kunst sowie intersektionale, dekoloniale und aktivistische Praktiken im Theater. Zurzeit arbeitet sie an Theatre in Post-migrant Germany. Performing Race, Migration and Coloniality since 1945 (Palgrave Macmillan) sowie Postmigrant Theatre - History, Aesthetics and Politics of a Theatre Movement (University of Toronto Press).

Mala Reinhardt
Mala Reinhardt arbeitet als Regisseurin und Produzentin von Dokumentarfilmen. Sie studierte Regie an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam und zuvor Ethnologie in Köln, Neu-Delhi und Kampala. In ihrer filmischen Arbeit konzentriert Mala sich vor allem auf unerzählte Geschichten aus migrantischer und feministischer Perspektive. Ihr Film „Der zweite Anschlag“(DOK Leipzig 2018) behandelt Rassismus und rechte Gewalt in Deutschland aus der Perspektive von Betroffenen. „Familiar Places“, ein sehr persönlicher Dokumentarfilm über Fragen nach Identität und Zugehörigkeit in einer postmigrantischen Gesellschaft premierte 2024 auf dem Locarno Film Festival (Sektion Semaine de la Critique).

Prof. Dr. Oliver von Wrochem
Prof. Dr. Oliver von Wrochem; Vorstand der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen und Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Derzeit auch zuständig für die Entwicklung des Dokumentationszentrums denk.mal Hannoverscher Bahnhof, das 2027 in der Hamburger HafenCity eröffnen soll.
Forschungsschwerpunkte: Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg, Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, Strafverfolgung von NS-Gewaltverbrechen.

Clarissa Thieme
Clarissa Thieme ist Filmemacherin und Künstlerin. Sie beschäftigt sich mit der Übersetzung individueller Erinnerung in historische Prozesse und den damit verbundenen Gewaltstrukturen. Ihr aktuelles Forschungsprojekt untersucht das Konzept eines lebendigen Archivs und Strategien der Verwundbarkeit als Widerstand. Sie hat Medienkunst und Kulturwissenschaften studiert und ist Alumna des Berlin Centre for Advanced Studies in Arts and Sciences. Derzeit promoviert sie am Artistic Research Centre der Filmakademie Wien (mdw). Seit den 2000er Jahren arbeitet sie intensiv im post-jugoslawischen Raum. Thieme ist Mitbegründerin von Između Nas / Between Us, einer offenen Archivinitiative im Videoarchiv Sarajevo. Ihr aktuelles Projekt „Save the Amazon Production - Resumption“ untersucht in Zusammenarbeit mit Berliner Künstler*innen und dem Videoarchiv Sarajevo künstlerische Praktiken als Widerstandsform. Gemeinsam mit der kurdischen Künstlerin Rozelin Akgün bereitet sie derzeit den Essayfilm „Vulnerability in Resistance“ vor, der Gewaltstrukturen und Widerstandsallianzen zwischen Amed, Istanbul und Berlin nachzeichnet.