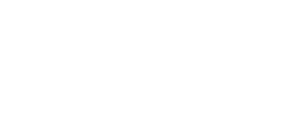Summer School "VR und AR in der NS-Geschichtsvermittlung"

Wie erzählen wir Geschichte im digitalen Raum? Wie prägen immersive Medien die Erinnerung an den Holocaust? Die diesjährige Summer School in Kooperation mit dem Brandenburg Museum fokussiert auf innovative Ansätze der digitalen Zeitzeugenschaft in der NS-Geschichtsvermittlung.
| Kurstermin: 29. September - 02. Oktober 2025 | Teilnehmendenzahl: max. 25 Personen |
| Veranstaltungsort: Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF | Zielgruppe: Gedenkstättenmitarbeiter*innen sowie Multiplikator*innen und Pädagog*innen der politischen Bildungsarbeit, Wissenschaftler*innen, Mitarbeiter*innen aus dem Museumskontext und Archiven |
| Sprache: Deutsch | Bewerbungsfrist: 20. Juli 2025 (Teilnahme kostenlos) |
Die viertägige Summer School lädt ein, sich zu vernetzen und weiterzubilden, um auf die Herausforderungen des schnellen digitalen Wandels sowie die zunehmende Bedeutung von immersiven Medien und künstlicher Intelligenz in der Erinnerungsarbeit vorzubereiten und ihre Möglichkeiten und Grenzen auszuloten. Neben wissenschaftlichen Vorträgen, Diskussionsrunden werden praktische Workshops und zahlreiche Praxisbeispiele vorgestellt und kritisch diskutiert. Die diesjährige Ausgabe findet im Rahmen des Projektes “In Echt? Virtuelle Begegnungen mit Zeitzeug*innen” statt.
Die Summer School kann einzeln besucht werden, ist gleichzeitig Auftakt für die Teilnehmer:innen des Memory Media Labs.
Die Bewerbungsfrist für 2025 ist beendet.


„In Echt? – Virtuelle Begegnung mit NS-Zeitzeug:innen“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte und der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF. Das Projekt wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.
Kontakt
Monika Richterweitere Informationen: Monika Richter Leitung Filmuni Summer School & Kinderfilmuni