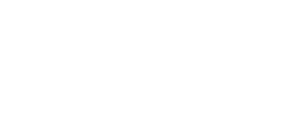Im Gegensatz zum zweidimensionalen Film, der sich „nur“ zunutze macht, wie unser Gehirn funktioniert, nämlich indem er durch das Spiel der Größenverhältnisse, des Lichts und Schattens etc. Perspektive schafft, den Raum erst entstehen lässt, erhält man beim stereoskopischen Filmen faktisch eine zusätzliche Achse, um seinen Raum selbst zu bestimmen.
Das Team dazu: "Wir sind als Künstler und Bildgebende damit dem Automatismus des Gehirns untergeordnet. Wir können damit spielen, aber keine eigenen Regeln aufstellen. Im 3D-Film können wir hingegen bestimmen, wie sich die Fixpunkte in unserem Raum zueinander verhalten sollen. Das ist eine tolle Chance und bietet viele Möglichkeiten. Es kann einen aber auch überfordern und dazu bringen, etwas ,falsch' zu machen: z.B. Schwindel statt Raum zu erzeugen. Viele 2D-Filme, die es ,auch in 3D' gibt, trauen sich wahrscheinlich deswegen nicht viel und schöpfen nur einen minimalen Bereich der bestehenden Möglichkeiten ab.
Analog dazu hat ihre Filmfigur, die im dreidimensionalen Raum einer digital-totalitären Dystopie lebt, auch Angst vor ihren Möglichkeiten. Sie trägt zwar den Wunsch nach Leben und Begegnung in sich, aber sie bleibt in ihrem verschlossenen Raum, vor ihrem Screen, an ihrer Maus sitzen. Ihr Leben findet ausschließlich auf dem zweidimensionalen Screen statt, stellvertretend geführt von ihrem virtuellen Ich. Der Schatten der Figur, ein gleichfalls zweidimensionaler Begleiter, leidet jedoch unter dem kalten, unnatürlichen Licht des Screens und will hinaus in die Welt. Er als Alter Ego des Lichts löst sich von der Figur, tritt hinaus: aus dem Guckkasten, in den Raum, vor den Screen. Die Zuschauer*innen begleiten ihren Schatten sodann dabei, wie er Plastiken, menschenleere Plätze, Straßen und Treppen, den gesamten Raum der dystopischen Stadt, in die er Bewegung zu bringen scheint, erforscht. Seine Mehrdimensionalität entspringt nicht aus ihm, sondern orientiert sich an den vorhandenen Formen. Es entsteht ein Spiel. Die Architektur, die Oberflächen und Strukturen wirken durch ihn lebendig.
"Wir sind an die Grenzen dessen gegangen, was der Raum filmisch erzählen kann, wenn man nicht versucht, ihn nachzuerzählen, sondern ihn lebendig werden lassen möchte. Und wir haben unsere eigene Angst vor den Möglichkeiten überwunden", so Mareike Almedom.
Ausgezeichnet mit dem Fördpreis für künstlerische Forschung des IKF
Projektleitung: Mareike Almedom
Team:
- Produktionsleitung: Milena Schäpers
- Regie: Kristina M. Almedom
- Bildgestaltung: Jan Philip Ernsting
- Operator: Manuel Schamberger
- Kamera-Assistenz: Sophia Fenn, Laura Thuy
- Montage: Franziska Wenzel
- Filmmusik/Komposition: Carl Ludwig Wetzig
- Gesang/Schauspiel: Joana Waluszko
- Choreographie: Yuko Matsuyama
- Szenenbild: Kathrin Meier
- VFX: Rui Xu, Isabell Siegrist