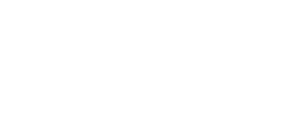Forschungsprojekte in der Lehre
Ausgewählte Projekte aus der Lehrforschung im Studiengang Medienwissenschaft
2024
Serienmarkt in (West-)Afrika. In Kooperation mit dem DFG-Teilprojekt Streaming-Serien: Raumgeschichten und Produktionsregime bei Afronovelas, TU Berlin
Zum (west)afrikanischen Serienmarkt hat bisher wenig bis gar keine Forschung stattgefunden, was auch auf die sehr junge Entstehung der Industrie zurückzuführen ist (Motsaathebe & Chiumbu, 2021). Doch seit den 2000ern haben sich besonders im Senegal, Ivory Coast, Burkina Faso und Nigeria neue Serien- und Filmproduktionsstrukturen entwickelt (Bisschoff, 2009, S. 441 454; Jedlowski, 2016, S. 174–193). Während immer mehr lokale Produktionskulturen entstehen, besteht weiterhin eine große Abhängigkeit von europäischen Förderstrukturen und Produktionsfirmen (bzw. Pay-TV- oder Streaminganbietern), wie Netflix und Canal+. Vor allem Canal+ hat in frankophonen westafrikanischen Ländern eine markttechnische Machtposition inne (Caillé & Forest, 2017). Es hat bisher kaum Versuche gegeben, einen Überblick über die komplexen Produktionsstrukturen in (West-)Afrika zu schaffen, weshalb eine grundlegende Marktbeobachtung sinnvoll erscheint, um Flows sowie die Position europäischer Player nachvollziehen zu können.
Das Forschungsprojekt ist eine Kooperation mit dem DFG-Teilprojekt C06: Streaming-Serien. Raumgeschichte und Produktionsregime in Afronovelas (Séverine Marguin und Daddy Dibinga, Technischen Universität Berlin). Das Forschungsprojekt des Masterstudiengangs Medienwissenschaft der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF ergänzt ihr Forschungsprojekt um eine Untersuchung aus Media Industry Perspektive.
Forschungsfrage: Welche transkontinental wirksamen Streamer/Sender agieren auf dem afrikanischen Serienmarkt, wie positionieren sich „Small Media Nations“ am Beispiel von Senegal, Côte d’Ivoire in diesem Kontext und wie zirkulieren dort entstandene Serien im afrikanischen und europäischen Raum?
Seminar: Populäre Medienkulturen, Prof. Dr. Susanne Eichner
Methoden: Dokumentenanalyse, Netzwerkanalyse, Mapping und Expert*innen-Interviews
2023
Soziale Klasse und Transformationspotenzial in populärer Unterhaltung
Soziale Herkunft ist und bleibt für individuelle Lebenswege bedeutsam, wobei insbesondere der sozioökonomische Status prägend wirkt. Während die Sozialstrukturanalyse in den Sozialwissenschaften eine Renaissance erlebt, blieb die systematische Auseinandersetzung mit sozialer Klasse in der Medienwissenschaft vergleichsweise unterbelichtet. Serien als komplexe, figurenorientierte Erzählform stellen jedoch ein zentrales Medium dar, in dem soziale Ungleichheiten nicht nur abgebildet, sondern auch performativ hervorgebracht werden. Die deutsche Serie PARA – Wir sind King (2021) bietet ein besonders aufschlussreiches Beispiel für die Darstellung sozialer Klasse, indem sie Erfahrungen junger Frauen in einem von Prekarität geprägten urbanen Umfeld verhandelt und Fragen nach Mobilität, Handlungsmacht und strukturellen Begrenzungen aufwirft. Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit, wie soziale Klasse in der Serie narrativ, visuell und figurenbezogen inszeniert wird und wie Zuschauer*innen das in der Serie präsentierte Transformationspotenzial wahrnehmen und deuten.
Forschungsfrage: Wie wird soziale Klasse in der Serie PARA – Wir sind King dargestellt? Und wie verhandelt das Publikum das in „PARA – Wir sind King“ dargestellte Transformationspotenzial?
Seminar: Populäre Medienkulturen, Prof. Dr. Susanne Eichner
Methoden: Fernsehanalyse und Gruppendiskussionen
Themenspektrum des gesellschaftlich engagierten Kinofilms in Deutschland seit 2009
Seminar: Medienproduktion und Mediendiskurse, Prof. Dr. Jens Eder
Methode: Datenanalyse
Neue Anforderungen - Wie sich junge Journalist*innen auf den Plattformen der sozialen Medien präsentieren
Zwischen Professionalität, Authentizität und der glaubwürdigen Vermittlung journalistischer Inhalte stehen heute besonders junge Journalist*innen auf den Plattformen der sozialen Medien vor zahlreichen Herausforderungen. Der Wettbewerb um Aufmerksamkeit am Arbeitsmarkt verstärkt die Dringlichkeit, das digitale Selbst durch Selbstvermarktung zu stärken, auch, indem etwas Persönliches preisgegeben oder geteilt wird. Dabei können die Grenzen zwischen beruflichen und privaten Inhalten verwischen. Das Forschungsmodul zielte darauf ab, das berufliche Selbstverständnis und die Selbstinszenierung junger Journalisten im deutschen Mediensystem in Verbindung mit der professionellen Nutzung sozialer Medien sowie die Trennung der Darstellung persönlicher und professioneller Inhalte zu analysieren. Im Vordergrund stand die Frage, wie sich junge Journalist*innen, die als „digital natives“ mit den sozialen Medien aufgewachsen sind und am Beginn ihrer Laufbahn stehen, auf sozialen Medien privat und beruflich präsentieren. Mit ihrem Fokus auf die Selbstdarstellung der Journalist*innen und ihre Strategien der Ausdruckskontrolle schließt die Studie theoretisch an die Arbeiten von Goffman zum Impression Management an. Wie die geführten Leitfadeninterviews Interviews zeigen, sind sich die Befragten zu einem hohen Maß der Inszenierung der eigenen Rolle bewusst. Die Darstellung der beruflichen Rolle auf der digitalen Bühne kann dazu dienen, das eigene Image zu profilieren und die Karriere durch Selbstmarketing voranzutreiben. Private Verweise sehen die Akteure als eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu generieren und Glaubwürdigkeit zu unterstreichen.
Seminar: Early Adopter - Junge Nutzergruppen, Prof. Dr. Claudia Wegener
Methode: Leitfadeninterviews
Publikation: C. Wegener, Y. Yurtaeva-Martens, A. Dornier, P. Eichel & L.C. Jung (2024). Between Private and Professional Roles: How Do Young Journalists Present Themselves on Social Media Platforms? Digital Transformation, Media and Social Inequalities, European Sociological Association (ESA) – Research Network 18: Sociology of Communications and Media Research Mid-Term Conference, 25-26 January 2024, Bukarest, Rumänien
Geschichte und Ästhetik des Kammerspielfilms
Obwohl die Geschichte des Kammerspielspielfilms mittlerweile über ein Jahrhundert und unzählige Beispiele aus vielen Ländern umfasst, sind die ästhetischen Konturen und motivischen Kontinuitäten des Genres von der Forschung bisher nur ansatzweise und punktuell ausgearbeitet worden. Durchaus strittig ist, ob sich kammerspielartige Filme überhaupt unter dem Begriff eines Genres vereinigen lassen oder ob sie sich nicht vielmehr bei der Inszenierung ihres Geschehens einer besonderen Modalität der raumzeitlichen Konzentration bedienen, wie sie in Werken ganz unterschiedlicher Gattungsprovenienz zum Tragen kommen kann. Im Seminar soll dieser offenen Frage an unterschiedlichen Beispielen nachgegangen werden, um zu historisch fundierten Einschätzungen der ästhetischen Eigenarten von Kammerspielfilmen zu gelangen. Es schlägt dabei den Bogen von den Anfängen des Kammerspielfilms im Weimarer Kino über das klassische Kino bis hin zu den Transformationen der Kammerspielform im Autoren- und Avantgardefilm der jüngeren Vergangenheit. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Möglichkeiten gelegt, die Formen der subtilen filmischen Artikulation psychologischer Dynamiken der Aushandlung von Geschlechterverhältnissen bieten. An individuell gewählten Beispielen kann in eigenständig definierten Forschungsvorhaben diesen und anderen Fragen nachgegangen werden.
Seminar: Geschichte von Film und Fernsehen, Prof. Dr. Michael Wedel
2022
Screening Britain: "Britishness*" in popular series. In cooperation with the AHRC-research project "Screen Encounters with Britain", King's College London
Das Projekt im Forschungsseminar „Populäre Unterhaltung” an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF setzte sich mit der Rezeption britischen TV-Contents in Deutschland auseinander und ist eine Kooperation mit dem Forschungsprojekt „Screen Encounters with Britain“ (SEB, Jeanette Steemers, Andrea Esser) des King's College London. Unter den Gesichtspunkten der transnationalen Medienforschung werden britische Serienformate auf dem deutschen Markt analysiert und im globalisierten Medienmarkt betrachtet. Einen entscheidenden Anknüpfungspunkt für die vorliegende Arbeit bildeten die ersten Ergebnisse der SEB-Erhebung aus Dänemark (vgl. Esser et al., 2023b). Diese förderten zutage, dass trotz der großen Bandbreite an exportierten britischen Serien einige Genres dominierten, die gemeinhin mit Britishness*2 assoziiert werden können, etwa Historie und Krimi. Darüber hinaus überraschte es, dass die Befragten einige US-amerikanische Produktionen als britische Serien nannten, zum Beispiel das Period Drama Bridgerton (USA, 2020-, Netflix). An diesen Punkten setzt nun das vorliegende Forschungsprojekt an. Denn die Ergebnisse lassen vermuten, dass ein entscheidender Faktor des Erfolges der Serien ihre lokale Verortung ist – sie sind also erfolgreich, weil sie als britisch erkennbar sind. Diese Beobachtung hinterfragt in bedeutender Weise jüngere Erhebungen, die gerade im Wirken. von global agierenden Streamingdiensten eine Tendenz zur Delokalisierung von Serieninhalten konstatiert. Das Forschungsprojekt geht deshalb von einer lokalen Perspektive aus, um sich dem Komplex internationaler Serien auf dem deutschen Markt zu nähern.
Forschungsfrage: Welche Rolle spielt die Artikulation von Britishness* bei populären britischen fiktionalen Serien in Deutschland?
Seminar: Populäre Unterhaltung, Prof. Dr. Susanne Eichner
Methode: Genreanalyse und Analyse der Marketingstrategie der Serien Bridgerton (Netflix, USA, 2020-), Downton Abbey (ITV, Großbritannien, 2010-2015), Peaky Blinders (BBC , Großbritannien, 2013-2022), Inspector Barnaby (ITV, Großbritannien, 1997-), KillingEve (BBC America, Großbritannien, 2018–2022) und Sherlock (BBC, Großbritannien, 2010-2017).
Wirkungen, Verwendungskontexte und Aufführungsbedingungen von gesellschaftlich engagierten Spielfilmen im Schulunterricht
Seminar: Medienproduktion und Mediendiskurse, Prof. Dr. Jens Eder
Methode: Konstellationsanalyse und Expert*inneninterviews
"Non-places" in Netflix Original Teen Drama Series
Seminar: Populäre Unterhaltung, Prof. Dr. Susanne Eichner
Methode: Textanalyse und Rezeptionsstudien mit 4 Focus Groups (deutsche, britische, amerikanische und jordanische Gruppe)
Conference Presentation:
Eichner, Susanne; Zech, Carla & Huchel, Christin: Non-Places as “Grammar of Transnationalism” in Netflix Original teen drama series at ECREA pre-conference 2022: Young people, entertainment and cross-media storytelling: Perspectives and methods for investigating youth media. Aarhus 2022.
Komik und Komödie bei F.W. Murnau
Die Stummfilme von Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931) markieren im Weimarer Kino wie im klassischen Hollywoodkino einen stilistischen Höhenkamm an dramatisch-expressiver Kraft und formaler Stringenz, der oft als Ausläufer eines spätromantische Kunstwillens in die Fluchtlinie einer tragischen Weltauffassung gestellt wird. Das Seminar will vor diesem Hintergrund einen eher unüblichen Blick auf den scheinbar so schwermütigen "Klassiker" Murnau werfen, indem es Stellenwert und Funktion von Komik und Humor in seinen Filmen (und einigen seiner Lebenszeugnisse) näher betrachtet. Neben Murnaus einziger überlieferter Filmkomödie Die Finanzen des Großherzogs (1923) und seiner Molière-Adaption Herr Tartüff (1925) bieten sich Passagen fast aller anderen Murnau-Filme unter diesen Gesichtspunkten einer eingehenderen Betrachtung an: Komisches und Humoristisches findet sich z.B. in Schloss Vogelöd (1921), Phantom (1922), Der letzte Mann (1924) und Faust (1926) ebenso wie in Sunrise (1927), City Girl (1930) und Tabu (1931). Nimmt man das Lachen als Motiv hinzu, kommen selbst Der Gang in die Nacht (1920) und Nosferatu(1921) für eine Reflexion seiner Bedeutung in Frage. Ziel des Seminars ist es, die von Studierenden eigenständig am Material erarbeiteten Erkenntnisse als Korrektiv des in der Filmgeschichtsschreibung vorherrschenden Murnau-Bildes zu profilieren.
Seminar: Mediengeschichte, Prof. Dr. Michael Wedel
2021
Das Pornographie-Kollektiv feuer.zeug: Alternative Praktiken in Repräsentation, Produktion und Distribution
Case Study, Expert:inneninterviews
Modul 13: Medienproduktion und Mediendiskurse, Prof. Dr. Jens Eder
Intellektuelle Filmberichterstattung – Zur Entwicklung kritischer Schreibweisen in den Medien
Aufbauend auf das Seminar „Medienintellektuelle“ aus dem Sommersemester 2021 und im Zusammenhang mit einem laufenden Publikationsvorhaben über die Aktivitäten von Autorinnen und Autoren der Zeitschrift „Filmkritik“ (1957-1984) in Rundfunk und Fernsehen widmet sich das Seminar dem Anteil, den Film und Kino als Kristallisationspunkte der Reflexion über Politik und Gesellschaft an der Herausbildung und Entwicklung einer kritischen Medienöffentlichkeit in der frühen Bundesrepublik zukommt. Im Zentrum der Seminardiskussion stehen zunächst im Rahmen des Publikationsprojekts in Sendearchiven recherchierte Fernseh- und Rundfunkbeiträge aus dem Umkreis der Zeitschrift „Filmkritik“ (z.B. von Enno Patalas, Wilfried Berghahn, Frieda Grafe, Ulrich Gregor, Harun Farocki oder Hartmut Bitomsky). Im weiteren Verlauf des Seminars können diese Beispiele je nach Interessenlage der Studierenden ergänzt und variiert werden, etwa im Hinblick auf parallele Entwicklungen in anderen europäischen Ländern, Protagonisten und Protagonistinnen anderer Filmzeitschriften (z.B. „Film“, „Frauen und Film“) und andere Formen einer kritischen Medienpraxis in Bezug auf Film und Kino.
Modul 11: Geschichte von Film und Fernsehen, Prof. Dr. Michael Wedel